Vermögen der AOK wächst weiter
Die gute Konjunktur- und Beschäftigungslage sorgen dafür, dass alle Krankenkassen im ersten Halbjahr schwarzen Zahlen geschrieben haben. Dabei fällt ein Detail zum wiederholten Male auf: Keine Kassenart schloss so gut ab wie die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK). Vom bisherigen Gesamtüberschuss in Höhe von 1,4 Milliarden Euro verbuchten die Ortskrankenkassen allein 650 Millionen Euro – das sind 47 Prozent.
Der Überschuss der Ortskrankenkassen je Mitglied lag mit 32 Euro deutlich über dem der Betriebskrankenkassen (13,80 Euro) und knapp ein Drittel über dem Überschuss der Ersatz- und Innungskrankenkassen (21 und 23 Euro). Dies belegt das offizielle Halbjahresergebnis aller gesetzlichen Krankenkassen, das dem Handelsblatt vorliegt.
Dabei sind nur 37 Prozent der 55,8 Millionen Beitragszahler bei einer AOK versichert und zahlen absolut bei den Ortskrankenkassen deutlich geringere Zusatzbeiträge. Die Mitglieder der Ortskrankenkassen zahlten einen Zusatzbeitrag von durchschnittlich nur 118 Euro. Bei Betriebskrankenkassen mussten die Mitglieder im ersten Halbjahr durchschnittlich 137 Euro von ihrem Nettoeinkommen zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz überweisen, die Mitglieder der Ersatzkassen wie Barmer und DAK zahlten 139 Euro zusätzlich und die der Innungskrankenkassen sogar 150 Euro.
Das bedeutet: AOK-Versicherte zahlen im Durchschnitt weniger Beitrag – trotzdem wächst das Vermögen der AOK von Monat zu Monat. Die Folge: Mit über acht Milliarden Euro entfällt fast die Hälfte der 17,2 Milliarden Euro Rücklagen im gesetzlichen Krankenversicherungssystem auf die Ortskrankenkassen. Je Mitglied hat die AOK dadurch 400 Euro auf der hohen Kante. Im Kassendurchschnitt sind es nur 300 Euro.
Der AOK Verband führt die überdurchschnittlich gute Finanzlage darauf zurück, dass die Kassen in jüngster Zeit vor allem viele junge Mitglieder neu gewonnen hätten. Auch die Leistungsausgaben entwickelten sich günstiger als bei anderen Krankenkassen.
Kritiker der AOK halten dagegen: Solche Faktoren könnten die Schieflage bei den Finanzierungsströmen im Gesundheitssystem nicht hinreichend erklären. Sie machen für das Ungleichgewicht den Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen verantwortlich, über den die Durchschnittskosten von 80 Krankheiten ausgeglichen werden.
Seit 2009 hängen die Beitragseinnahmen einer einzelnen Kasse nicht mehr in erster Linie von der Konjunktur sowie von Zahl und Einkommen ihrer Versicherten ab. Vielmehr muss jede Kasse ihre Beitragseinnahmen vollständig an den Gesundheitsfonds überweisen. Dieser schüttet dann jeden Monat aus den gesamten Einnahmen und dem jährlichen Steuerzuschuss von rund 14 Milliarden Euro eine festgelegte Kopfpauschale pro Versicherten an die Krankenkassen aus.
Diese Pauschale ist gestaffelt nach bestimmten Kriterien wie Alter, Geschlecht, Erwerbsminderungsstatus der Versicherten und der daran gekoppelten durchschnittlichen Gesundheitsausgaben. Zusätzlich gibt es Zuschläge für 80 Krankheiten. Kommen die Kassen mit diesen Zuweisungen nicht aus, müssen sie einen prozentualen Zusatzbeitragssatz erheben. Die Einnahmen aus diesem Zusatzbeitrag können sich bei den Kassen unterjährig erhöhen, die Zuweisungen aus dem Fonds dagegen sind fix.
„Die Musik für Kassen wie die AOK spielt bei diesen Zuweisungen deshalb vor allem im krankheitsorientierten Teil des Finanzausgleichs“, sagt Gerd Glaeske. Der Bremer Gesundheitsökonom weiß wovon er redet. Er war Vorsitzender des Beirats, der seinerzeit die Entwicklung des neuen Finanzausgleichs wissenschaftlich begleitet hat.
„Die Gretchenfrage lautete damals: Welche 80 Krankheiten nehmen wir, um einen neuen stärkeren Finanzausgleich zu erreichen, der für die Kassen möglichst faire Wettbewerbsbedingungen schafft und nicht manipulationsanfällig ist?“ Bis dahin wurden Unterschiede in der „Morbiditätslast“ zwischen den Krankenkassen im Ausgleich überhaupt nicht berücksichtigt.
Krankheitsliste stieß auf Kritik
Der Beirat war dafür, vor allem besonders teure Krankheiten auszugleichen. Der entsprechende Gesetzentwurf sah vor, dass diese Krankheiten „eng abgrenzbar, schwerwiegend und chronisch“ sein und eine „besonders Bedeutung für das Versorgungsgeschehen“ haben müssten. Vor allem aber sollten die durchschnittlichen Behandlungskosten je Patient die durchschnittlichen Leistungsausgaben für alle Versicherten um mindestens 50 Prozent übersteigen.
Die auf Basis dieser Vorgaben präsentierte Krankheitsliste stieß beim Bundesgesundheitsministerium jedoch auf Kritik. Der Beirat hatte bewusst Erkrankungen wie Rheuma, einfache Diabetes, Asthma oder Depressionen ohne schweres Krankheitsbild nicht in die Liste aufgenommen, weil sie zwar häufig vorkommen, aber keine hohen Behandlungskosten auslösen und oft auch schwer abgrenzbar und zu diagnostizieren sind. Auch lassen sich viele dieser Erkrankungen durch gesunde Lebensführung und präventive Maßnahmen vermeiden.
Der Widerstand aus dem damals von Ulla Schmidt (SPD) geführten Bundesgesundheitsministerium war vor allem aus einem Grund absehbar: Es stellte sich schnell heraus, dass die strenge Krankheitsauswahl den damals eindeutig benachteiligten Ortskrankenkassen nicht die Zusatzeinnahmen bringen würde, die politisch erwünscht waren. Das unausgesprochene Hauptziel der Reform war, den chronisch notleidenden Ortskrankenkassen durch den verstärkten Finanzausgleich finanziell wieder auf die Beine zu helfen.
Das weitere Vorgehen beschreibt Glaeske so: „Als die Beiratsmitglieder aus dem Urlaub zurückkamen, gab es eine neue Liste. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Neu auf die Liste kamen chronische Krankheiten, die nicht viel kosten, aber bei den Versicherten der Ortskrankenkassen besonders häufig vorkommen. Schon damals warnte Glaeske, dass durch die Berücksichtigung dieser Krankheiten der Ausgleich manipulationsanfällig würde. Er sah die Gefahr einer Morbidisierung der Gesellschaft.
Der Beirat trat deshalb 2008 aus Protest geschlossen zurück. Glaeskes Nachfolger wurde Jürgen Wasem. Der Inhaber des Lehrstuhls für Medizinmanagement an der Universität Duisburg Essen hatte sich für die neue Position in besonderer Weise empfohlen: Er hatte in Zusammenarbeit mit Klaus Jacobs, dem Leiter des wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen, und anderen die sogenannte „Essener Liste“ verfasst. Eine Zusammenstellung, auf der die meisten Krankheiten schon vermerkt waren, die die AOK sich wünschte.
Glaeskes Vorhersagen sind mittlerweile eingetreten: Aktuelle Untersuchungen belegen, dass sich das Krankheitsspektrum seit 2009 in Richtung der Krankheiten verschoben hat, für die es aus dem Finanzausgleich Zuschläge gibt.
Ortskrankenkassen aber auch andere große Kassen wie die Barmer oder die TK standen unter dem Verdacht, sie hätten systematisch Ärzte per Beratung oder mit Geld ermuntert, gesicherte Diagnosen für ausgleichstechnisch lukrative Krankheiten zu stellen – die Staatsanwaltschaft ermittelte. Inzwischen hat der Gesetzgeber mit Wirkung ab 11. April jede Form der Einflussnahme der Krankenkassen auf die Diagnosestellung gesetzlich verboten.
In einem Mahnschreiben des Bundesversicherungsamts (BVA) an alle Krankenkassen zählt Präsident Frank Plate noch einmal einige der „Sündenfälle“ auf, die es seit Einführung des neuen Ausgleichs gegeben hat. Verboten sei, so Plate, dass eine Kasse Arztdiagnosen nachträglich korrigieren lässt. Damit hat sich vor allem die AOK-Rheinland-Hamburg hervorgetan. Krankenkassenvertreter oder von ihnen beauftragte Dritte dürften die Ärzte nicht bei der Diagnosestellung beraten. Diesen Weg hatten vor allem Ortskrankenkassen gewählt. So sieht sich die AOK Nordwest staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt, nachdem Ärzte sich darüber beschwert hatten, von Mitarbeitern der Kasse bedrängt worden zu sein, Diagnosen so zu ändern. Die Kasse weist die Vorwürfe zurück.
Für Unruhe und Prüfaktivitäten sorgten beim BVA noch weitere Vorwürfe: Einzelne Ortskrankenkassen hätten Saisonarbeiter aus benachbarten EU-Ländern weiter in der Kartei geführt, obwohl sie längst in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren. Die Kassen erhielten für die Arbeiter Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, denen folglich keinerlei Leistungsausgaben gegenüberstanden. Auch hier reagierte die Bundesregierung inzwischen mit Klarstellungen im Sozialgesetzbuch.
Negativschlagzeilen für den Finanzausgleich
BVA-Präsident Plate drohte noch im Mai allen Krankenkassen Zwangsgelder von bis zu zehn Millionen Euro an, die nicht mit dem Amt bei der Aufklärung entsprechender Vorwürfe zusammenarbeiten. Inzwischen haben sich die Ortskrankenkassen in einer gemeinsamen Erklärung verpflichtet, Ärzten nur noch besondere Leistungen, nicht aber das Stellen bestimmter Diagnosen zu vergüten.
Doch die Vorwürfe sind damit nicht vom Tisch. Im Gegenteil: Betreuungsstrukturverträge und Hausarztverträge gibt es immer noch – und sie sind völlig legal. Formal versprechen sie den Ärzten nämlich nur Zusatzentgelte, wenn sie bestimmte Patientengruppen intensiver betreuen. Aber auch heute fließt das Geld nur für Patienten mit einer „gesicherten Diagnose“. Und dabei gilt häufig nach wie vor: Je kränker der Patient, umso höher das Zusatzhonorar. Ein Schelm wer schlechtes dabei denkt.
Die Negativschlagzeilen haben zusammen mit der finanziellen Schlagseite des Finanzausgleichs zugunsten der AOK dazu geführt, dass Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe bereits Ende 2016 Gutachten in Auftrag gegeben hat. Unter anderem soll auch evaluiert werden, wie eine Manipulationsanfälligkeit des Finanzausgleichs in Zukunft verhindert werden kann.
Gerd Glaeske hätte da schon einen Vorschlag: Die Krankheitsauswahl müsste von den Volkskrankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck wieder in Richtung teurer und schwerer, und daher auch diagnostisch viel leichter abgrenzbarer Krankheiten verändert werden. Manipulationen würden so schwerer und der Finanzausgleich fairer werden, ist Glaeske sicher.
Die Sache hat aber einen entscheidenden Haken: Der wissenschaftliche Beirat unter Führung von Jürgen Wasem wurde mit der Bewertung des Ausgleichs und seiner Manipulationsanfälligkeit beauftragt. Für die Evaluation wurden ihm zwei Wissenschaftler an die Seite gestellt: Der mit Wasem aus früherer Zusammenarbeit eng verbundene niederländische Finanzausgleichsexperte Wynand van de Ven und der Wettbewerbsökonom und Chef der Monopolkommission Achim Wambach.
Glaeske hält die Tatsache, dass der Erfinder des Finanzausgleichs, der auch für seine Weiterentwicklung seit 2009 die Verantwortung trägt, nun quasi federführend die eigene Arbeit evaluiert, schlicht für ein Unding. „Wasem ist viel zu sehr befangen, um objektiv urteilen zu können. Wir brauchen endlich eine externe Bewertung dessen, was mit dem Finanzausgleich passiert.“
Auf der anderen Seite führt an Professor Wasem im deutschen Gesundheitswesen aber schon lange kein Weg mehr vorbei. Überall wo es in der deutschen Gesundheitspolitik knifflig wird, ist der Professor aus Essen nicht weit. So ist er aktuell Vorsitzender der Landesschiedsämter für die vertragsärztliche Versorgung im Rheinland und in Sachsen.
Seit 2007 leitet er den Erweiterten Bewertungsausschuss für die vertragsärztliche Versorgung, der auf der Bundesebene im Streitfall zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über die Honorare für die niedergelassenen Ärzte entscheidet. Seit Juli 2015 ist Wasem sogar unparteiischer Vorsitzender der Schiedsstelle zur Festsetzung von Preisen für patentgeschützte Arzneimittel. Wenn sich der pharmazeutische Hersteller und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen nicht auf einen Preis einigen, kommt der Professor ins Spiel – sehr zur Zufriedenheit der pharmazeutischen Industrie, wie man hört.
Zahllos sind Wasems Nebenämter in Beiräten von privaten Krankenversicherungen und Beratungsgremien von Verbänden im Bereich des Gesundheitswesens. Auch den Hauptkritikern des aktuellen Finanzausgleichs, den Betriebskrankenkassen, war er lange beratend eng verbunden. Dabei rühmen alle seine hohe fachliche Expertise.
Ob sich die Ämterhäufung Wasems noch mit dem Anspruch an wissenschaftliche Unabhängigkeit vereinbaren lässt, daran gib es aber schon Zweifel. Eigentlich sollten Wasem, van de Ven und Wambach ihre Evaluation bis Ende dieses Monats abgeschlossen haben. Doch daraus wird nichts werden, heißt es in Krankenkassenkreisen. Vor dem Jahresende seien keine Ergebnisse zu erwarten. Das könnte bedeuten, dass das Streitthema Finanzausgleich bei den Koalitionsverhandlungen einfach ausgespart werden wird.

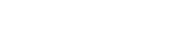 Yahoo Kino
Yahoo Kino 

