Unternehmen gründen undurchsichtige Bürgerinitiativen – und die EU finanziert sie mit
In den kommenden Monaten kommt viel Arbeit auf Eamonn Bates zu. Denn die EU-Kommission will seinen Kunden einen schweren Schlag verpassen. Noch im Mai will sie voraussichtlich den Verkauf von Einweggeschirr verbieten. Damit bedroht sie das Geschäftsmodell von Fast-Food-Ketten und Verpackungsherstellern gleichermaßen. Bates arbeitet für beide. Er ist Generalsekretär an der Spitze des europäischen Verbands der Fast-Food-Branche. Der heißt „Serving Europe“, und in ihm haben sich Branchengrößen wie McDonald’s und Burger King zusammengeschlossen. Die gleiche Funktion hat der Ire auch beim europäischen Verband der Verpackungsindustrie namens Pack2go.
Es wäre nicht das erste Mal, dass die EU-Kommission noch kurz vor Ende der Legislaturperiode ein weitreichendes Verbot durchsetzt. Vor fünf Jahren etwa hat sie mit der Änderung einer Richtlinie im Hauruckverfahren die Verwendung von Plastiktüten stark eingeschränkt. „Ohne echte Debatte“, erinnert sich Lobbyist Bates. „Aber Politiker greifen halt gern zu Maßnahmen, von denen sie sich einen Imagegewinn versprechen“, ergänzt er.
Den Kampf um Becher, Messer und Gabeln aus Plastik gibt Bates jedoch noch nicht verloren. Als ebenso findiger wie erfahrener Berater setzt er dabei auf ein effizientes und zugleich irreführendes Instrument. Seinen dritten Job als Generalsekretär übt Bates nämlich beim Clean Europe Network aus. Der Zusammenschluss diverser Initiativen, Organisationen und Recycling-Unternehmen tritt wie eine idealistische Nichtregierungsorganisation (NGO) auf. Die Visitenkarte ziert neben gelben Sternen auch das Piktogramm eines umweltbewussten Bürgers, der brav seinen Müll an der richtigen Stelle entsorgt.
Dabei sind die Botschaften des Clean Europe Network ganz im Sinn von Bates’ Kunden aus der Industrie. Für ihren Müll sollen vor allem die Verbraucher und weniger die Hersteller verantwortlich sein. Letztere sollten allenfalls freiwillig Aufräumkosten übernehmen. Der Konsument, so heißt es etwa in einem Positionspapier, dürfe nicht den Eindruck bekommen, dass er beim Kauf auch ein „Recht zur Vermüllung“ miterworben habe. Der Befund passt perfekt in den Kampf für den Erhalt des Plastikgeschirrs.
Dass im Eingang der von Bates gegründeten Agentur im Brüsseler Europa-Viertel ein Gemälde mit gesichtslosen Männern in Grau hängt, wirkt angesichts der strategischen Flexibilität der Agentur fast schon antiquiert. Lobbyarbeit wird in Brüssel heute nicht mehr nur in Kostüm und Anzug, sondern auch in Hoody und Lederjacke betrieben. Industrievertreter setzen vermehrt auf vermeintlich unabhängige Bürgerinitiativen und Thinktanks, um die politische Meinungsbildung in ihrem Sinne zu beeinflussen. „Das gehört heute schon fast zum Standardrepertoire“, sagt Daniel Freund von Transparency International.
In den USA hat sich diese Praxis als „Astroturf“ schon länger etabliert. Der Name leitet sich von einer bekannten Marke für Kunstrasen ab und ist zugleich Programm. Wer keine echte Graswurzelbewegung an seiner Seite weiß, schafft sich eben selbst eine. Vor allem Branchen mit zweifelhaftem Image unterstützen oder gründen Bewegungen, die ihre Botschaften aussenden und dabei authentisch wirken. Bei vielen Politikern kommt das an. Da sie sich nicht von den Bedürfnissen der Bürger entfernen wollen, neigen sie dazu, NGOs mehr Aufmerksamkeit zu schenken als Industrielobbyisten. Wer tatsächlich hinter der angeblichen Volksbewegung steht, bleibt ihnen jedoch oft verborgen.
Steuergeld für Lobbyarbeit
In Deutschland war der schwedische Energiekonzern Vattenfall Vorreiter der Praxis. Als er im Osten des Landes noch luftverschmutzend Braunkohle förderte, finanzierte er zugleich den Verein „Pro Lausitzer Braunkohle“. Als Sprachrohr einer angeblich schweigenden Mehrheit brachte der auf seiner Website und bei Veranstaltungen Argumente für den Kohleabbau unter die Leute. Bis heute ist nicht bekannt, wie viel Geld von Vatenfall floss. Vereine, NGOs und andere Initiativen der Zivilgesellschaft müssen ihre Einkünfte nicht offenlegen.
Genau diese Lücke macht es Unternehmen einfach, falsche Graswurzeln anzulegen. Selbst wenn die NGOs Informationen herausrücken, also freiwillig angeben, für wen sie arbeiten, machen sich Politik und Verwaltung nicht die Mühe, genau hinzusehen. So weist etwa das Clean Europe Network brav darauf hin, dass die angeblich so umweltbewusste Organisation zugleich Mitglied im Verband der Verpackungshersteller ist.
Die EU-Kommission hat die Arbeit der zweifelhaften NGO trotzdem mit Steuergeld gefördert. 2013 überwies sie 250 000 Euro, 2015 noch mal 167 600 Euro an das Netzwerk. Angesichts dieser Großzügigkeit kann sich der Verpackungsverband finanziell zurückhalten. Er beschränkt sich auf eine Zuwendung von 7500 Euro im Jahr.
Ein Start-up namens Facebook
Die bewusst gewählte Intransparenz ruft erste Politiker auf den Plan. „Es müsste nachvollziehbar sein, wer hinter Organisationen steckt“, fordert etwa der grüne Europa-Abgeordnete Jan Philipp Albrecht. Er weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er die erste große Welle Astroturf in Brüssel direkt miterlebt, als er an der Datenschutzverordnung arbeitete. Bevor das Gesetz vor gut zwei Jahren verabschiedet wurde, mischte sich eine European Privacy Association in die Debatte ein. Die gerierte sich als neutraler Thinktank, der vor allem die Interessen von Mittelstand und Start-ups vertrat. In Wahrheit standen jedoch Facebook, Google und Microsoft hinter der Organisation.
Ähnliches hat sich gerade erst bei einer Gruppe namens Fairsearch herausgestellt. Die hat in Brüssel eine Beschwerde gegen Google wegen angeblicher Wettbewerbsverstöße beim Betriebssystem Android eingereicht. Dominiert wird die Organisation von den Konzernen Oracle und Naspers. Die Start-ups, deren Interessen sie angeblich in erster Linie vertritt, dürfen bei ihr zwar mitmachen, haben aber keine Stimmrechte.
Für Lobbyfirmen wie die in Washington ansässige DCI Group gehört es zum Standardangebot, authentisch wirkende Gruppen aufzusetzen. Seinen Kunden verspricht das Unternehmen ganz ungeniert, „gleichgesinnte Freunde anzuheuern“, um „größere Resonanz“ für eine Position herzustellen. DCI ist nach Europa expandiert, andere Agenturen kopieren das Modell.
Als die EU vor fünf Jahren die europäische Bürgerinitiative einführte, boten Lobbyprofis ihren Kunden prompt an, für sie Unterschriften in EU-Ländern zu sammeln und damit Gesetzesänderungen in ihrem Sinne zu fordern.
Die angeblich unabhängigen Gruppen üben ihren Einfluss subtil aus. Als etwa die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in Brüssel kürzlich zu einer Diskussion zum Thema Sammelklagen lud, trat das European Justice Forum (EJF) offiziell als Mitveranstalter auf. Das hält sich selbst für die „einzige europäische Organisation, die sich ausschließlich darauf konzentriert, ein faires Justizsystem zu schaffen“. Tatsächlich handelt es sich beim EJF um einen Zusammenschluss von Konzernen und Anwaltskanzleien. Große Versicherer wie Swiss Re und Zurich lassen sich ihre Mitgliedschaft jährlich 60.000 Euro kosten.
„Wir wollen vermeiden, dass Sammelklagen amerikanischen Stils nach Europa kommen“, umschreibt EJF-Direktor Ekkart Kaske die Mission des Zusammenschlusses. Doch der offizielle Veranstaltungsbericht der Konrad-Adenauer-Stiftung legt nahe, dass der Kampf weiter reicht. So schildert ein EJF-Vertreter ausgiebig die angeblichen Vorteile sogenannter „alternativer Streitbeilegungsverfahren“. Das Thema ist brisant und hoch aktuell: Als Reaktion auf den Dieselskandal will die EU-Kommission im April vorschlagen, wie Verbraucher künftig in allen EU-Staaten kollektiv als Kläger auftreten können. Die Aussicht behagt dem EJF wenig. Dabei stützt sich die Organisation auf angeblich „wissenschaftliche Untersuchungen“ – und ganz offenbar auch auf erfahrenes Lobbywissen. Wer in ihrem Sekretariat anruft, landet direkt in der US-PR-Agentur Edelman.
Die rauchen gern
„Lobbyisten sind keine dummen Leute. Sie schauen, wer Informationen am unverfänglichsten transportieren kann“, sagt der CDU-Europa-Abgeordnete Karl-Heinz Florenz. Das gilt umso mehr, je stärker eine Branche im Visier der Regulierer steht. Die Zigarettenindustrie, die unter Rauchverboten und der Pflicht zu Warnhinweisen leidet, will allzu starken Schutz von Nichtrauchern über Umwege als Gängelung darstellen. Dafür finanzieren Konzerne wie British American und Imperial Tobacco einen Zusammenschluss bekennender Raucher namens Forest. Das Akronym steht für „Freedom Organisation for the Right to Enjoy Smoking Tobacco“. Die Gruppe präsentiert sich als Verein von Genießern und Freigeistern und wirbt damit, dass der britische Maler David Hockney bei ihr Mitglied ist.
Der Schutz vor angeblicher Bevormundung ist häufig ein beliebtes Argument im Kampf der Argumente. So gibt auch das seit einem Jahr in Brüssel ansässige Consumer Choice Center vor, „mehr Wahlmöglichkeiten und Freiheit für Konsumenten“ anzustreben. Die Gruppe stellt sich auf ihrer Website als „unabhängige Einheit“ dar, die keiner politischen Partei nahesteht. Dass 90 Prozent ihres Budgets von Großunternehmen aus Branchen wie Tabak, Alkohol, Lebensmittel, Handel, Gesundheit und Pharma stammen, ist weniger transparent. „Aus Respekt für unsere Sponsoren nennen wir die Unternehmen nicht“, sagt Direktor Frederik Roeder.
Der Gesundheitsökonom beklagt, dass klassische Verbraucherschützer Innovationen verhinderten. Die stille Mehrheit, die jene Neuerungen wolle, werde von ihnen nicht vertreten. Roeders Idealbild ist eine Welt, in der kein Staat mehr den Fahrdienst Uber regulieren will, sondern mündige Verbraucher selbst entscheiden, ob sie den Fahrern vertrauen. Als 2014 in Berlin Taxifahrer gegen Uber protestierten, hat er mit zwei Freunden spontan eine Gegendemo organisiert. Dabei handelte er tatsächlich aus Überzeugung. Denn Uber, das versichert Roeder, gehöre nicht zu seinen Geldgebern.

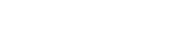 Yahoo Kino
Yahoo Kino 


