Pistole an den Kopf, Film ab: In Venedig gehen ganz besondere Filmfestspiele zu Ende
Ein Filmfestival in Corona-Zeiten: Venedig hat vorgemacht, wie das geht. Um den Goldenen Löwen konkurriert auch ein Beitrag aus Deutschland.
Dass Kino immer auch ein Risiko ist, das stimmte bislang vor allem für Filmemacher und für Produzenten. In Corona-Zeiten aber gilt das auch fürs Publikum. Zusammen mit Dutzenden, gar Hunderten anderen in einem geschlossenen Raum, und das über Stunden? Nicht jedem ist wohl bei diesem Gedanken. In Venedig, wo an diesem Samstag die 77. Ausgabe der Film-Biennale mit der Verleihung des Goldenen Löwen zu Ende geht, mussten sich die Filmliebhaber gar eine Pistole an die Stirn halten lassen, wenn sie ins Kino wollten. Allerdings auf gutem Grunde: Wer aufs Gelände der Mostra ging, dem wurde mit einer Fieberpistole die Körpertemperatur gemessen, beim Einlass in die Säle dann sogar ein zweites Mal.
Überhaupt hatten die Verantwortlichen um Biennale-Chef Alberto Barbera viel getan, um zu verhindern, dass ihr Festival als Hotspot in die Geschichten dieser Pandemie eingeht. So wurden gefühlt mehr Spender für Desinfektionsmittel bereitgestellt, als Venedig Brücken hat; überall galt Maskenpflicht, sogar in den Sälen und während der Vorstellungen. Was mitunter zur Folge hatte, dass man mit Jury-Präsidentin Cate Blanchett im selben Kino saß und die stets mit einem Einwegmodell maskierte Schauspielerin schlicht nicht erkannte.
Es war leerer als sonst in diesem Jahr in Venedig - nicht nur in der Stadt selbst, der die Pandemie eine kleine Auszeit von den Touristenmassen gegönnt hat. Auch auf dem Festivalgelände waren weniger Besucher unterwegs als in den Vorjahren. In den Kinosälen musste jeder zweite Sitz freigelassen werden, sodass etwa im messehallengroßen Riesensaal "Palabiennale" nur knapp 900 statt der sonst rund 1.800 Zuschauer Platz fanden.
Die Corona-Regeln, sie galten auch auf dem roten Teppich. Für die Fotografen durften die Masken kurz abgenommen werden, mehr nicht. Das Publikum musste allerdings sowieso draußen Platz nehmen - der Laufsteg der Stars war mit Wänden abgesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Was freilich nur zur Folge hatte, dass sich die Neugierigen um jene kleinen Schlitze drängten, die einen Blick erlaubte auf das Vorbeiflanieren der Schauspielerinnen und Schauspieler im Blitzlichtgewitter. Ein bisschen Glamour muss eben sein.
Große Stars am Lido
Neben Jury-Präsidentin Blanchett und ihren Kollegen (darunter der deutsche Regisseur Christian Petzold und US-Schauspieler Matt Dillon) war auch Tilda Swinton an den Lido gekommen. Die Schottin erhielt, zusammen mit der aus Hongkong stammenden Regisseurin Ann Hui, den Goldenen Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk. Zu sehen war sie in Pedro Almodóvars toller Kurzfilm-Adaption "The Human Voice" nach Jean Cocteaus Bühnenstück - eine fantastische Ein-Frau-Vorstellung, die zeigte, warum Swinton völlig zu Recht geehrt wurde. Als Nächstes, verriet der nach Venedig gereiste Almodóvar, wolle er unter anderem einen "völlig andersartigen" Western drehen. Ob mit oder ohne Swinton, ließ er offen.
Star der Biennale war unbestritten Vanessa Kirby. Die Britin, die man bislang aus Filmen wie "Fast & Furious" kannte, war in zwei der interessantesten Wettbewerbsbeiträge zu sehen. In "Pieces of a Woman", dem englischsprachigen Debüt des Ungarn Kornél Mundruczó, spielt die 32-Jährige eine Frau, deren Baby unmittelbar nach der Geburt verstirbt. Alleine für die rund 15-minütige Geburtsszene, die in einem Take gedreht wurde, hätte Kirby den Oscar verdient. Man glaubte ihr gerne, als sie bei der anschließenden Pressekonferenz von einer der größten Herausforderungen ihrer Karriere sprach. Und dann war da noch ihr zweiter Film, "The World To Come" der Norwegerin Mona Fastvold. An der Seite einer großartigen Katherine Waterston gab Kirby eine Bäuerin, die sich im ländlichen Amerika des ausgehenden 19. Jahrhunderts in eine andere Frau verliebt. Ein eindringlicher, wenn auch den Umständen der Zeit entsprechend deprimierender Film.
Einmal abgesehen von Ausnahmen wie Quentin Dupieux' wunderbar schräger, außer Konkurrenz gezeigten Spinnerei "Mandibule" (in dem Film versuchen zwei Verlierertypen, eine gigantische Fliege als Bankräuberin abzurichten), gab es wenig zu lachen am Lido. "Milestone" von Ivan Ayr etwa war ein tristes Sozialdrama aus der indischen Unterschicht, Roderick Mackay ließ in seinem Down-Under-Western "The Furnace" den australischen Goldrausch in viel Blut versinken. Der italienische Eröffnungsfilm "Lacci" von Daniele Luchetti nahm das Glück einer Mittelstandsfamilie auseinander, im eindringlichen, sehr sehenswerten Bosnienkriegs-Drama "Quo Vadis, Aida?" ließ Jasmila Zbanic die Schrecken des Massakers von Srebrenica noch einmal geschehen. Großes Starkino hingegen war "Nomadland" von Chloé Zhao. Die Chinesin, die aktuell auch am Marvel-Film "The Eternals" arbeitet, erzählt in ihrem Wettbewerbsbeitrag von einer Frau (Frances McDormand), die ein Leben außerhalb der Gesellschaft sucht, nachdem sie zuvor all ihr Hab und Gut verloren hat.
Deutscher Wettbewerbsbeitrag
Die Filme, die in Venedig gezeigt wurden, beschäftigten sich naturgemäß nur wenig mit der Pandemie. Eine Ausnahme war etwa die dokumentarische Collage "Sportin' Life" von Outlaw-Regisseur Abel Ferrara ("Bad Lieutnant"), der seine Beobachtungen von der letzten Berlinale mit Aufnahmen aus den pandemiegeplagten USA vermischte. Oder der - ebenfalls dokumentarische - Kurzfilm "Fiori, Fiori, Fiori!" von Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name"), der für seinen 15-Minüter das postpandemische Sizilien besuchte.
Kino dürfe "nicht außerhalb der Realität stattfinden", hatte der von Biennale-Direktor Barbera nach Venedig geladene Cannes-Chef Thierry Frémaux zu Beginn des Festivals gesagt. Wie man an diesem Anspruch scheitern kann, zeigte Gia Coppola (die Enkelin von Francis Ford und Nichte von Sofia Coppola) in "Mainstream", ihrem Beitrag für die "Horizonte"-Reihe. Andrew Garfield spielt einen YouTube-Star, der vom Erfolg korrumpiert wird und schließlich eine junge Frau in den Selbstmord treibt. Erzählt wird das so schrill und so rasant wie ein TikTok-Video, aber leider auch etwa so tiefgründig eine der 15-Sekunden-Clips auf der Plattform.
Deutschland war zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder mit einem Wettbewerbsfilm am Lido. "Und morgen die ganze Welt" hat Regisseurin Julia von Heinz ihr Antifa-Drama kämpferisch betitelt. Mala Emde ("Charité") spielt eine junge Frau aus gutem Hause, die sich in Mannheim einer linken Gruppe anschließt. Anfangs demonstriert sie mit ihren neuen Freunden noch friedlich gegen Rechtsextreme, bald aber radikalisiert sie sich und greift zu Gewalt. Emde spielt diese Rolle fantastisch - dennoch bleibt ihre Figur leider ziemlich flach, über ihre Motivation verrät das Drehbuch so gut wir gar nichts.
Auch Regina King ist mit ihrer zweiten Regiearbeit "One Night in Miami" ganz nah dran am Heute, auch wenn sie ihren Film im Jahr 1964 spielen lässt, genauer: in der Nacht zum 25. Februar 1964. Cassius Clay (Eli Goree) war gerade Weltmeister im Schwergewichtsboxen geworden, als er zusammen mit seinen Freunden Malcolm X, Sam Cooke und NFL-Star Jim Brown in einem Hotelzimmer über das Schwarzsein in Amerika diskutiert. "Sie erschießen unsere Leute auf den Straßen", sagt Malcolm X (gespielt von Kingsley Ben-Adir), und Regisseurin King meint das nicht nur als historisches Zeugnis, sondern durchaus auch als Appell an die Gegenwart.

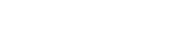 Yahoo Kino
Yahoo Kino 










