IBMs Supercomputer stellt sich dumm an
Eine wahre Wundermaschine, davon ist Virginia Rometty, Chefin des IT-Konzerns IBM, überzeugt, ist ihr Watson. Ein Supercomputer, der mithilfe künstlicher Intelligenz all die Aufgaben löse, an denen die Menschheit bisher gescheitert sei. Und so scheute die Vorstandsvorsitzende auch keinen noch so großen Marketingjubel: In einem TV-Werbespot parliert Watson mit Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan über Songtexte. Und beim Super Bowl, dem Finale der Football-Meisterschaft, pries Schauspieler Jon Hamm, bekannt als Don Draper aus der Serie „Mad Men“, die Vorzüge Watsons: „Er hilft Ärzten dabei, Krankheiten zu bekämpfen; er kann Muster im globalen Wetter vorhersagen – und die Bildung von Kindern verbessern“, schwärmte Hamm. „Watson ist eines der leistungsfähigsten Werkzeuge, das die Menschheit je gebaut hat.“
Und so euphorisch wie die Werbung klingen auch die Geschäftspläne, die Rometty mit Watson hegt. Die gesamte Zukunft des IT-Riesen soll auf dem Geschäft mit künstlicher Intelligenz ruhen. Und dessen zentraler Baustein ist Watson. Er soll helfen, die seit 21 Quartalen in Folge sinkenden Erlöse von Big Blue wieder zu steigern. „Watson wird der nächste Mondflug für IBM – vor allem im Gesundheitswesen“, sagt Rometty.
Doch nun bereitet der Hoffnungsträger der Konzernchefin Probleme. Nicht nur, dass das Geschäft mit künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Cloud Computing nach zuvor zweistelligen Wachstumsraten im zweiten Quartal dieses Jahres nur noch um fünf Prozent wuchs. Es mehren sich auch die Zweifel an Watsons Fähigkeiten. Zuerst fiel das Programm bei einer staatlichen Ausschreibung für den Kampf gegen Cyberterroristen in Italien durch. Dann sorgte ein Bericht in den USA für Aufsehen, dass Watson mit der Auswertung von Daten im Kampf gegen Krebs überfordert sei. Und nun rücken nach Informationen der WirtschaftsWoche große Unternehmenskunden vom IBM-Supercomputer ab.
So haben die weltgrößten Rückversicherer Munich Re und Swiss Re laufende Watson-Projekte beendet oder reduziert. „IBM wird aktuell Opfer der Erwartungshaltung, die man selber durch aggressives Watson-Marketing bei den Kunden geschürt hat“, sagt Axel Oppermann vom IT-Analysehaus Avispador. Welche Zukunft also hat der Supercomputer?
Beim Münchner Rückversicherer Munich Re gehört der Umgang mit großen Datenmengen von jeher zum Geschäftsmodell. Wer auf Datengrundlage die Risiken dieser Welt richtig einschätzt, kann im Versicherungsgeschäft deutlich mehr Geld verdienen. Also waren sie in München wie elektrisiert, als IBM die gigantischen Datenverarbeitungsmöglichkeiten seines Watsons anpries. Und so starteten die Versicherer vor zwei Jahren den Einsatz Watsons. Auf drei Feldern, dem Schadensmanagement, der Risikoeinschätzung etwa bei Klimarisiken sowie der Absicherung von Lieferkettenunterbrechungen, sollte Watson helfen.
Doch mittlerweile hat die Munich Re den Einsatz beendet. Offiziell äußern will sich der Konzern dazu nicht. In Unternehmenskreisen heißt es, Watson habe keinen Mehrwert gebracht: „Der Funke ist einfach nicht übergesprungen.“ Insider berichten, ein Grund für den Abbruch der Kooperation seien die hohen Kosten gewesen. „Es gibt inzwischen kleinere Anbieter, die ähnliche Lösungen zum Teil deutlich günstiger anbieten“, sagt ein mit dem Projekt vertrauter Berater. Ein anderer Insider berichtet, Munich Re habe für Leistungen gezahlt, die IBM nie erbracht habe, und für Funktionalitäten, die es gar nicht gab.
Vorbehalte hatten die Münchner offenbar auch hinsichtlich der Sicherheit ihrer Daten. Bei vielen Watson-Modulen muss der Anwender Daten in die Cloud verschieben. Das habe die Munich Re nicht gewollt, sagt der Insider. „Dass viele Anwendungen nur über die Cloud laufen, ist noch immer ein großes Problem für viele Kunden – und somit auch für IBM und den Erfolg von Watson“, sagt auch Avispador-Analyst Oppermann.
IBM hofft auf Versicherer
So verzichtete der Schweizer Rückversicherer Swiss Re, der vor zwei Jahren einen Watson-Einsatz startete, von vorneherein auf Cloud-Anwendungen, wie das Unternehmen betont. Ein gutes Dutzend Watson-Projekte ging die Swiss Re mit IBM an, unter anderem zur Bewertung von Cyberrisiken. Inzwischen ist auch in Zürich Ernüchterung eingekehrt. Bei einer Reihe von Projekten nutzt die Swiss Re nicht mehr Watson, sondern Konkurrenzangebote, berichtet ein Kenner. „Das Projekt bei Swiss Re ist längst gescheitert“, sagt ein anderer Insider. Watson, so der Insider, sei vor allem eines: „Ein Musterknabe für gelungenes Marketing.“
„Der Markt ist noch auf der Suche nach Anwendungsfeldern“, beschreibt Stephan Maier, Versicherungsexperte bei der Unternehmensberatung EY Innovalue. Dabei sind es, neben Anbietern von Medizintechnik, vor allem die Versicherer, von denen sich IBM das große Geschäft mit Watson erhofft. Bei der Zusammenarbeit mit der Assekuranz blickt IBM auf eine lange Historie zurück, denn viele Versicherer sind seit Jahrzehnten treue Nutzer der IBM-Großrechner. Umso schlimmer, wenn ausgerechnet diese treuen Altkunden frühzeitig von der Fahne gehen.
Auf Anfrage stellt IBM fest: „Weder IBM Deutschland noch die IBM Corporation haben jemals einen Vertrag zu Watson mit der Munich Re abgeschlossen. Wir haben jedoch eine gut funktionierende Geschäftsbeziehung mit der Munich Re, die wir an dieser Stelle nicht weiter kommentieren werden.“ Die Situation bei der Swiss Re kommentiert IBM wie folgt: „Es gibt keine Änderungen an unserer Zusammenarbeit mit Swiss Re zum Einsatz von Watson. Swiss Re arbeitet an einer branchenweiten Palette von Lösungen zur Unterstützung unterschiedlicher interner Prozesse und hat im Oktober 2015 in Zusammenarbeit mit IBM ein eigenes Kompetenzzentrum für kognitives Computing eingerichtet. Unsere bestehende Kundenbeziehung werden wir auch hier nicht weiter kommentieren.“ Zudem verweist IBM Deutschland auf ein erfolgreiches Projekt bei der Versicherungskammer Bayern (VKB): Die VKB habe an verschiedenen Stellen immer wieder betont, wie gut die Watson Technologie in diesem Projekt – bei dem es darum geht, Angebotswünsche, aber auch Unmutsäußerungen von Kunden in der schriftlichen Kommunikation zu erkennen – funktioniere.
Die WirtschaftsWoche hält an ihren Rechercheergebnissen fest. Nicht nur Großkonzerne sind, so ergaben Gespräche mit Insidern, ernüchtert. Selbst die von IBM verbreitete Behauptung, Watson helfe wegen seiner enormen Datenauswertungsmöglichkeiten bei der Erkennung und damit Heilung von Krankheiten, hat sich als übertrieben herausgestellt.
Im Juli wurde publik, dass das Krebsforschungszentrum MD Anderson ein Watson-Projekt wegen Erfolglosigkeit beendet hat; Watson sei „weder bereit für den klinischen Einsatz noch die Forschung“. Zuvor hatte das an die University of Texas in Houston angeschlossene Institut 60 Millionen Dollar in die Watson-Technologie investiert. Und drei Jahre nachdem IBM begonnen hat, Watson als Wunderwaffe zur Auswahl der besten Krebstherapie zu verkaufen, haben nach Recherchen des US-Medizininformationsdienstes „Stat“ aus Boston gerade mal ein paar Dutzend Krankenhäuser bei der Technologie zugegriffen. Das ist weit entfernt vom IBM-Ziel, hier ein neues Milliardengeschäft aufzubauen.
Antonio Samaratini wäre eigentlich ein idealer Verbündeter Watsons. Der graumelierte Italiener hat eine bilderbuchartige Karriere in der IT-Industrie hingelegt, arbeitete unter anderem acht Jahre für IBM, bevor er vor zweieinhalb Jahren angeheuert wurde, Italien als Chef einer Digitalagentur am Sitz des Ministerpräsidenten ins digitale Zeitalter zu führen. Ein IBM-Manager an der Spitze einer staatlichen Einrichtung: Da gäbe es allerlei Projekte, um mithilfe der IBM-eigenen Superintelligenz so manches Datenchaos im italienischen Staatswesen zu ordnen. Und so machte sich Samaratini auch daran, Watson einzubinden. Doch nun, zweieinhalb Jahre nach Dienstantritt, ist Samaratinis Hoffnung gedämpft.
Insgesamt sei es noch immer „übertrieben“, von einer realistischen Nutzung künstlicher Intelligenz im Behördenumfeld zu sprechen.
Wer sich aber eingehender mit Samaratinis Experimenten beschäftigt, ahnt: Womöglich liegen die Probleme bei Watson auch tiefer, als die Kosten- und Sicherheitsargumente der Versicherer vermuten lassen – und Watson ist einfach Opfer einer Über-Inszenierung, die mit einem Missverständnis über die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz spielt. Darauf jedenfalls deutet eine Analyse hin, die Samaratinis Behörde angefertigt hat. Demnach funktioniert Watson, allerdings eher als eine Art Superrechner und weniger als Intelligenz-Instanz im herkömmlichen Sinne.
Die Digitalagentur hat bis Mai dieses Jahres den IT-Markt nach einer Software gesichtet, die aus digitalen Texten mögliche Gefährdungen durch Cyberterroristen herausfiltert. Langfristig sollen alle italienischen Sicherheitsbehörden mit einer solchen Software ausgestattet werden, die auch die Erkenntnisse der Fahnder untereinander vernetzt. Auf die entsprechende Ausschreibung für einen Test bewarben sich IBM mit der Watson-Anwendung Cyber-Security und Expert System mit seiner Software Cogito. Nun räumt selbst Samaratinis Behörde ein, dass IBM lediglich „wenig detaillierte“ Unterlagen zu den Fähigkeiten der Watson-Software eingesandt habe.
Allerdings urteilen die Italiener: Watson erlaube, um Texte zu analysieren, nur den Blick in vorhandene Wörterbücher oder Listen mit feststehenden Begriffen, es benutze nur „statistische Modelle, aber keine semantischen“. Sprich: Die künstliche Intelligenz in Watson ist einfach ein superschneller Rechner und Datenauswerter, aber keine Intelligenz in dem Sinne, dass die Maschine sich selbst verbale Sachverhalte erschließt. Für die Textanalyse mit Blick auf Cyberterrorbedrohungen also sei Watson schlechter als das Konkurrenzprodukt Cogito. Das könne sich nämlich auch semantische Sachverhalte erschließen. Für Letzteres entschieden sich die Italiener dann auch für ihren Test. IBM wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren.
Wie also geht es nun weiter mit dem vermeintlich so schlauen Watson? IBM-Finanzchef Martin Schroeter warb bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen im Juli erneut um Geduld: „Wir verzeichnen weiter eine weltweit steigende Watson-Nutzung.“
Das sehen Analysten kritisch: Die Investmentbank Jefferies hat in einer parallel veröffentlichten Studie untersucht, ob die Watson-Technologie den IBM-Investoren wenigstens mittelfristig einen höheren Unternehmenswert liefern werde. Das Ergebnis: „Unsere Analyse legt nahe, dass IBMs Erträge aus den Watson-Investitionen nicht über den Kapitalkosten liegen werden“, schreibt Analyst James Kisner in seiner Zusammenfassung. Das ernüchternde Fazit zur IBM-Aktie: „Underperform“ – zu Deutsch: hinter den Erwartungen zurückbleibend.
KONTEXT
So lernen Maschinen das Denken
Wahrnehmen
Mit Kameras, Mikrofonen und Sensoren erkunden die Maschinen ihre Umwelt. Sie speichern Bilder, Töne, Sprache, Lichtverhältnisse, Wetterbedingungen, erkennen Menschen und hören Anweisungen. Alles Voraussetzungen, um etwa ein Auto autonom zu steuern.
Verstehen
Neuronale Netze, eine Art Nachbau des menschlichen Gehirns, analysieren und bewerten die Informationen. Sie greifen dabei auf einen internen Wissensspeicher zurück, der Milliarden Daten enthält, etwa über Personen, Orte, Produkte, und der immer weiter aufgefüllt wird. Die Software ist darauf trainiert, selbstständig Muster und Zusammenhänge bis hin zu subtilsten Merkmalen zu erkennen und so der Welt um sie herum einen Sinn zuzuordnen. Der Autopilot eines selbstfahrenden Autos würde aus dem Auftauchen lauter gelber Streifen und orangefarbener Hütchen zum Beispiel schließen, dass der Wagen sich einer Baustelle nähert.
Agieren
Ist das System zu einer abschließenden Bewertung gekommen, leitet es daraus Handlungen, Entscheidungen und Empfehlungen ab - brems etwa das Auto ab. Bei sogenannten Deep Learning, der fortschrittlichsten Anwendung künstlicher Intelligenz, fließen die Erfahrungen aus den eigenen Reaktionen zurück ins System. Es lernt zum Beispiel, dass es zu abrupt gebremst hat und wird dies beim nächsten Mal anwenden.

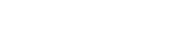 Yahoo Kino
Yahoo Kino 


