"Get Out": Clevere Sozialkritik in nervenaufreibender Verpackung

Ein dunkelhäutiger Mann, der mit einer weißen Frau zusammen ist. In der heutigen, aufgeschlossenen Zeit doch das normalste der Welt - möchte man meinen. "Get Out" von Regisseur Jordan Peele nimmt sich dieser Thematik an und hüllt die damit einhergehende Sozialkritik geschickt in ein neues Genre-Gewand. Aus dem "bösen schwarzen Mann" wird in "Get Out" nämlich der Held eines eindringlichen Horrorfilms, der beim Kennenlernen seiner schneeweißen Schwiegereltern in spe buchstäblich durch die Hölle geht.
Willkommen in der Familie
Chris (Daniel Kaluuya) könnte nicht glücklicher sein. Als Fotograf hat er ein Auge für die besonderen Momente des Lebens, seine Karriere geht durch die Decke. Und auch in der Liebe läuft es: bis über beide Ohren ist er in seine hübsche Freundin Rose (Allison Williams) verliebt. Nur eines bereitet ihm Sorgen: Wie werden seine ahnungslosen Schwiegereltern darauf reagieren, dass ihre Tochter mit einem Afro-Amerikaner zusammen ist?
Schnell scheinen sich allerdings all seine Zweifel in Luft aufzulösen, als er regelrecht überschwänglich von Roses Eltern empfangen wird. Sowohl Mutter Missy, als auch ihr Vater Dean scheinen von der ersten Sekunde regelrecht einen Narren an Chris gefressen zu haben. Doch ebenso schnell verfliegt die Illusion des Landidylls und Neuankömmling Chris beginnt, sich und Rose unangenehme Fragen zu stellen: Warum hat das reiche Elternpaar nur dunkelhäutige Bedienstete? Weshalb verhalten sich diese wie grenzdeblie Psychopathen? Und was hat es mit ihrer Mutter auf sich, die Chris per Hypnose um jeden Preis das Rauchen abgewöhnen will? Binnen kürzester Zeit schreien all seine Instinkte unisono: "Get Out" - raus hier!
Schwarz auf Weiß
"Nur weil du eingeladen wurdest heißt nicht, dass du willkommen bist". Das Hauptplakat von "Get Out" verrät tatsächlich so einiges über den Film. Und das, obwohl darauf doch nur Hauptfigur Chris schreiend in einem Sessel vor strikt getrenntem, schwarz-weißen Hintergrund sitzt. Es ist exakt diese Trennlinie zwischen Schwarz und Weiß, die der Film mit teils überdeutlicher Bildsprache und Aussagen der Protagonisten in den rund 105 Minuten Laufzeit thematisiert. Und die Scheinheiligkeit vieler ach so fortschrittlichen Menschen aufdeckt.
Da schwärmt der Familienvater (Bradley Whitford) in einem Moment von Präsident Obama, dem "besten Präsidenten seit Lincoln". Ein Familienfreund beteuert Hauptfigur Chris später, wie gerne er doch Golfspieler Tiger Woods habe. Erst nach und nach erfährt der Zuschauer, welche alptraumhafte Absicht hinter dieser Faszination für Afro-Amerikaner steckt. Denn derartig unbeholfene Versuche reicher, weißer Männer, ihre vermeintliche Progressivität kundzutun, nutzt "Get Out" geschickt, um aus ihnen den Stoff für einen nervenaufreibenden Horrorfilm zu spinnen.
Den Spieß umgedreht
Nun wird einigen Zuschauern dieses wortwörtliche Schwarz-Weiß-Denken von "Get Out" aber zu weit gehen. Jeder Kaukasier im Streifen wirkt wie eine Ausgeburt der Hölle, während die Afro-Amerikaner allesamt aufrichtig und gutmütig dargestellt werden. "Umgedrehter Rassismus", gab es in einigen Kommentaren erboster US-Zuschauer bereits zu lesen. Derartige Beschuldigungen verlieren aber schnell ihre Grundlage, wenn man sich die Überspitzung des Films vor Augen führt.
"Get Out" verkehrt ganz offenkundig die in vielen Filmen etablierten Versatzstücke und Rollenverteilungen. Dass "die Weißen" als die Bösewichte dargestellt werden, ist also keinesfalls aus Zufall oder latentem Rassismus geschehen. Vielmehr scheint "Get Out" jedem beleidigten Zuschauer, der sich über die "Schwarz-Weiß"-Darstellung echauffiert, eine schallende Ohrfeige zu geben und zeitgleich entgegenzurufen: "genau SO fühlt es sich an, in den Medien wegen seiner Hautfarbe diskriminiert zu werden". Für einen Horrorfilm mit mickrigen 4,5 Millionen Dollar Budget eine Aussage, die so manches Multimillionen-Drama mit zig Hollywood-Superstars nicht besser hätte an den (weißen) US-Mann bringen können.
Maßgeblich für den Erfolg dieser Botschaft zeichnet sich Hauptdarsteller Daniel Kaluuya verantwortlich. Ein Film gänzlich mit unbekannten Schauspielern zu besetzten kann immer ein Risiko, aber auch eine Chance sein. Sowohl Kaluuya als allzeit liebenswerte Hauptfigur, durch dessen Augen der Zuschauer die düstere Seite der amerikanischen Vorstadt-Idylle (David Lynchs "Blue Velvet" lässt grüßen) miterlebt, als auch Allison Williams als seine Freundin Rose haben diese Chance genutzt und Eigenwerbung betrieben. Denn, so viel sei verraten, auch Rose ist nicht die Person, für die sie sich ausgibt - ebenso wenig wie der Rest ihrer schrägen Familie.
Der Horror hält sich in Grenzen
Natürlich ist diese Form der Geschichtsbewältigung in erster Linie ein sehr US-amerikanisches Thema. Wem die noch immer anhaltende Aufarbeitung der Sklaverei aber nicht interessiert, für den wird "Get Out" als reiner Horrorfilm dem Hype im Vorfeld des Kinostarts wohl nicht gerecht. Denn beraubt man Jordan Peeles Film der sozialkritischen Note, beziehungsweise entscheidet sich dazu, sie zu ignorieren, bleibt ein sehr durchschnittlicher Horror-Thriller übrig. Einer, der in seinen Schockmomenten leider genau den Mut zur Innovation vermissen lässt, den er bei seiner Aussage beweist. Mit ohrenbetäubenden, schrillen Tönen für den obligatorischen "Jump-Scare" etwa, nach dem Genre-Kenner die Uhr stellen können.
Auch sonst ist "Get Out" in erster Linie als psychologischer Horror zu verstehen. Auf Blut und Gedärm muss der Splatterfan lange verzichten, auch der Showdown vergießt den Tomatensaft nicht in Litern. Stattdessen beweist "Get Out" in vielen Momenten sogar eine komödiantische Seite, wenn Chris nach und nach die dunklen Machenschaften seiner Schwiegereltern aufdeckt. Oft beraubt Komik einen Horrorfilm seines Schreckens, bei "Get Out" ergibt sich dabei aber ein stimmiger Genremix.
Fazit
"Get Out" ist einer der wenigen Horrorfilme, die mehr sein wollen, als eine bloße Abfolge von Schockmomenten. Tatsächlich könnte man diese sogar als einen der Schwachpunkte des Films aufzählen. Jordan Peele verbindet das Genre stattdessen geschickt mit Sozialkritik auf der einen und Humor auf der anderen Seite. Herausgekommen ist ein Genremix mit sehr amerikanischer Thematik, der nichtdestotrotz auch in Europa seine Fans finden wird.
Foto(s): © Universal Pictures

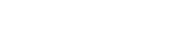 Yahoo Kino
Yahoo Kino 
