Gab es den Obama-Effekt in Hollywood?
Acht Jahre ist Barack Obama nun als US-Präsident an der Macht. Am 20. Januar nächsten Jahres wird er das Zepter - man will es sich noch immer nicht vorstellen - an Donald Trump übergeben. Acht Jahre, in denen der 44. Präsident der Vereinigten Staaten vieles erreicht hat, aber auch an einigen wichtigen Punkten gescheitert ist. Kritiker werfen ihm vor, sein Versprechen in der Guantanamo-Frage nicht eingehalten zu haben. Außerdem sei er beim umstrittenen Waffengesetz ebenso gescheitert wie als Krisenmanager bei Konflikten in Syrien und Afghanistan. Die Einführung der “Obamacare” und der Homo-Ehe, die Stabilisierung der US-Wirtschaft und der Einsatz für die Gleichberechtigung der Frau gehören jedoch zu Obamas großen Errungenschaften.

Das Kino in seiner Zeit
Hat Obama auch Spuren im US-Kino hinterlassen? Kann man hier von einem Obama-Effekt sprechen? Schließlich hat die Geschichte gezeigt, dass es durchaus Wechselwirkungen zwischen Politik und Kino geben kann. Die so genannte McCarthy-Ära etwa brachte Filme hervor, die die Kommunismus-Paranoia in der US-Gesellschaft zum Thema hatten; im New-Hollywood-Kino spiegelte sich auch das erschütterte Selbstverständnis der US-Gesellschaft in infolge des Vietnam-Krieges; in den 1970ern gab es Filme, die sich mit der Watergate-Affäre auseinandersetzen; das Action-Kino blühte unter der Reagan-Periode voll auf und das heutige Zeitalter des Big Data hat die James-Bond-Reihe nachhaltig verändert und desillusionierte Helden wie Jason Bourne hervorgebracht.
Während der neue Actionheld eine Erscheinungsform der digitalen Jetztzeit ist und das digitale Zeitalter sich mit dem Superhelden-Kino selbst feiert, hat sich im Hintergrund auch eine kleine Nische mit anspruchsvollen Filmen etabliert, die man durchaus als Folgewirkung der liberalen Aufbruchstimmung unter Obama sehen kann. Auffällig ist etwa der hohe Anteil von Produktionen, die die Diskriminierung von Minderheiten, im Speziellen dunkelhäutiger Bürger in den USA behandeln.

Filme um Rassendiskriminierung
Auch wenn die Filmemacher das Thema oft in ein historisches Gewand hüllen, sind Anspielungen auf gegenwärtige Verhältnisse nicht von der Hand zu weisen. Steve McQueens “12 Years a Slave” oder Quentin Tarantinos “Django Unchained” handeln zwar vordergründig von der längst überwundenen Sklaverei in den Vereinigten Staaten, implizit geht es in den Filmen aber um das noch immer aktuelle Problem der Rassendiskriminierung im Land. Auch dass Ava DuVernay mit “Selma” den Kampf Martin Luther Kings um Gleichberechtigung aufgreift, ist als kritischer Kommentar zur Gegenwart zu verstehen, die in den vergangenen Jahren von Protesten infolge von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen geprägt war.
Andere Filmemacher sind deutlicher mit ihrer Kritik am Status quo. Im Biopic “Nächster Halt: Fruitvale Station” behandelt Ryan Coogler die sinnlose Tötung des Afroamerikaners Oscar Grant durch einen weißen Polizisten in einer U-Bahnstation. Einige Filme behandeln den Alltag farbiger US-Bürger, der mal von eklatanter, mal von latenter Diskriminierung bestimmt ist. “The Help” kreist um eine Haushälterin, die ein Buch über die Gewalt-Erlebnisse schwarzer Haushälterinnen schreiben will. “Der Butler” erzählt die Lebensgeschichte des Butlers Eugene Allen, der unter mehreren Präsidenten im Weißen Haus diente.

Erfolgsgeschichten
Lee Daniels’ “Der Butler” ist auch bestes Beispiel dafür, dass sich mit Biopics nicht nur das Leid, sondern auch Erfolgsgeschichten von Afroamerikanern erzählen lassen. Zuletzt feierte F. Gary Gray mit “Straight Outta Compton”, einem Biopic über die einflussreiche Hip-Hop-Combo N.W.A., einen künstlerischen und finanziellen Erfolg. Natürlich darf in der Ära Obama auch kein Film über das Leben des Präsidenten fehlen. Mit “My First Lady” hat Richard Tanne allerdings eine kitschige Schnulze über das erste Date zwischen Barack und der späteren First Lady Michelle gedreht.
Durchbruch schwarzer Filmschaffender
‘Yes, we can’, das berühmte Motto Obamas während seines ersten Wahlkampfes, haben im Lauf seiner Amtszeit auch viele Filmschaffende verinnerlicht. Die Jahren seit 2008 sind nicht nur die Zeit üblicher Verdächtiger wie Spike Lee, Will Smith, Denzel Washington, Samuel L. Jackson und Morgan Freeman. Auch etliche Nachwuchsregisseure und -schauspieler starten Aufsehen erregend durch. Filmemacher wie Ava DuVernay, Ryan Coogler, F. Gary Gray, Lee Daniels und Nate Parker (“The Birth of a Nation”) stehen nicht nur für sozial engagiertes, sondern auch handwerklich perfektes Kino. Man kann nur hoffen, dass sie in Zukunft nicht gänzlich in den Mainstream abdriften, wie es sich bei DuVernay (“A Wrinkle in Time”), Coogler (“Black Panther”) und Gray (“Fast & Furious 8”) bereits abzeichnet.

Besonders bemerkenswert ist der Erfolg afroamerikanischer Schauspieler in den letzten acht Jahren. Talente wie Quvenzhané Wallis, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman, Chiwetel Ejiofor und John Boyega werden von der Welle sozial engagierter Filme direkt in den Hollywood-Olymp gespült. Viele von ihnen bekommen tragende Rollen in Franchise- und Genre-Produktionen, etwa Boyega in “Star Wars: Das Erwachen der Macht” und Jordan in “Fantastic Four” und “Creed: Rocky’s Legacy”. Der Zugkraft dieser neuen Superstars ist es auch zu verdanken, dass demnächst mit “Black Pather” die erste Comic-Verfilmung um einen schwarzen Superhelden in die Kinos kommt.
#OscarsSoWhite
So erfolgreich afroamerikanische respektive ‘nicht-weiße’ Filmschaffende in den Obama-Jahren auch sind, umso auffälliger ist vor diesem Hintergrund die Weigerung Hollywoods, ihre Leistungen anzuerkennen. Bezeichnenderweise wird in den Jahren 2015 und 2016 kein einziger schwarzer Schauspieler in den Darsteller-Kategorien für einen Oscar nominiert. Kandidaten dafür gibt es zuhauf, etwa Will Smith (“Erschütternde Wahrheit”), Idris Elba (“Beast of no Nation”) oder David Oyelowo (“Selma”). Nach einer Welle der Entrüstung und einer hitzig geführten Debatte um das Thema 'Oscars so white’ verkündet die Academy of Motion Picture Arts and Science um die afroamerikanische Präsidentin Cheryl Boone Isaacs einen 'historischen Maßnahme’-Katalog. So wolle die Academy die Zahl der Frauen und Angehörigen von Minderheiten unter ihren Mitgliedern bis 2020 verdoppeln. Die Zukunft wird zeigen, ob das fruchten wird.

Immerhin scheint sich die Aufregung um den Mangel an Diversität in Hollywood bereits jetzt auszuzahlen. Der Blick auf die Listen der diesjährigen Nominierten bei den Screen Actors Guild Awards und den Golden Globes stimmt optimistisch. Bei den Globes geht mit “Moonlight” ein Film von Barry Jenkins ins Rennen um den besten Film. Denzel Washington (“Fences”) und Ruth Negga (“Loving”) konkurrieren jeweils um den Hauptdarsteller-Preis. Bei den SAGs sind gar drei farbige Schauspielerinnen in der Nebendarsteller-Kategorie nominiert, Viola Davis (“Fences”), Naomi Harris (“Moonlight”) und Octavia Spencer (“Hidden Figures”). Hoffentlich wird diese Entwicklung in der Ära Trump nicht wieder gebremst, bevor sie richtig in Fahrt kommt.
(Bilder: 1. Michael B. Jordan in “Nächster Halt: Fruitvale Station”, Quelle: DCM (Delphi Filmverleih); 2. Chiwetel Ejiofor in “12 Years a Slave”, Quelle: Universal Pictures; 3. “Straight Outta Compton”, Quelle: Universal Pictures); 4. Quvenzhané Wallis in “Beasts of the Southern Wild”, Quelle: MFA+ Film Distribution); 5. Denzel Washington und Viola Davis in “Fences”, Quelle: Paramount Pictures)

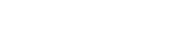 Yahoo Kino
Yahoo Kino 
