Wie sich ein Fischproduzent neu erfand
Die Revolution, die der Unternehmer Jürg Knoll einst startete, beginnt fast jeden Tag aufs Neue – immer um Mitternacht, auf einem Schiff mitten im Indischen Ozean. „Platsch.“ „Platsch.“ „Platsch.“ Viele Male, kurz nacheinander. Dann schwimmt ein Pulk Männer durch das Ozeanwasser. In den Händen halten sie Netze, mit denen sie kleine Köderfische fangen.
Ernsthaft gehen sie ihrem Handwerk nach. Suchen, schwimmen, tauchen, stellen Netze. Nach einer Zeit, als die Sonne sich schon blutrot an den Horizont schiebt, klettern sie mit dem Fang wieder an Bord, halten nach Vögeln Ausschau, folgen ihnen zu den Thunfischschwärmen vor den Malediven.
Dann stehen sie an der Reling, jeder eine Angel in der Hand, aus schlichtem Bambus gefertigt. Die Vögel schreien. Das Meer gluckst. Die Männer schweigen. Untätig sind sie nicht, aber konzentriert. Schließlich muss den Thunfischschwarm vor ihnen das Jagdfieber packen. Nur dann geht der Plan der Fischer auf.
Als der Kapitän das Signal gibt, wirft einer der Angler die Köderfische ins Wasser. Ein Schwarm Thunfische nähert sich. Die Männer schalten eine Sprenkelanlage ein, die dicke Wassertropfen auf den Meeresspiegel fallen lässt, als ob Hunderte kleiner Fische aus dem Wasser tanzen. Genau das denken auch die Thunfische. Gleich einem Fischballett schießen sie in die Höhe, schnappen nach den von den Fischern nun erneut geworfenen Köderfischen – und landen selbst am Haken. Die Fischer reißen die Rute hoch, schleudern den Fisch hinter sich und lassen ihn auf das Schiffsdeck plumpsen. Unzählige Male geht das so.
Es ist später Vormittag, als die Männer in den Hafen auf Mandhoo zurückkehren und Jürg Knoll, der sich das hier alles ausgedacht, das Spektakel von Deck aus verfolgt hat und später davon berichten wird, auf das Ergebnis schaut. Wenige Wochen später wird er die Fische als eingedoste Exemplare in Deutschland wiedersehen. Dort werden sie seine Geschichte, die des Lebensmittelunternehmens Followfood, weitertragen. Eine Geschichte über eine uralte Branche. Einen mittelständischen Fischhändler. Und über die Kraft, die disruptive Ideen auch kleinen Fischen gibt.
Es grassiert ja eine Reihe von Missverständnissen über dieses Wort: Disruption. Etwa, dass diese zwingend eine internetgetriebene Veranstaltung sei. Oder dass Mittelständler Opfer, nie Gestalter seien. Beides ist Quatsch. Das jedenfalls beweisen Knoll und sein Partner und Studienfreund Harri Butsch. Ihr Friedrichshafener 20-Mann-Unternehmen mit der Marke Followfish steht nicht nur dafür, dass Geschäftsmodelle sich in allen Branchen schon immer ständig wandeln. Es zeigt auch, wie ein Mittelständler einem Markt neue Regeln auferlegen kann, wenn seine Idee nur gut genug ist.
Als Knoll und Butsch das Unternehmen im Jahr 2000 gründen, importieren sie Fisch aus Russland. Doch bald wird die Konkurrenz zu groß, das Geschäft zu schwierig. Die beiden stehen vor einer Entscheidung: Aufgeben? Oder gegen den Markt arbeiten, es als Winzling mit den Großen wie Deutsche See, Gosch und Nordsee aufnehmen?
Sie entscheiden sich für das Wagnis, führen eine Technik ein, die ihnen hilft, die Herkunft der Fische genau zu überprüfen und bei bedrohten Fischen bestandsschonend zu fischen. Heute hat nahezu jeder in der Branche das System von Followfood übernommen. Sie haben gewissermaßen die Regeln verändert. Und Knoll und Butsch führen ihr Unternehmen noch immer nach einer Devise: Nur wenn du dich dauernd veränderst, wirst du bleiben, was du bist.
Leicht gesagt. Aber wie genau soll das gehen? Vier Regeln helfen Knoll und Butsch, dabei zu bleiben.
Beerdige dein Geschäftsmodell rechtzeitig
Die Geschichte beginnt an einem Wintertag vor zehn Jahren. „Die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann“, sagt Knoll, habe ihn im Dezember 2007 ereilt. Er hatte sich damals mit seinem ehemaligen Studienfreund Butsch zum Experten für Fischimporte aus Russland hochgearbeitet. Zander stand auf ihrer Liste ganz oben, ein Brot-und-Butter-Fisch von Gastronomie und Handel, keine besonderen Probleme, keine besondere Perspektive. Der Markt galt für mittlere Unternehmen als undankbar, Zander war nun auch nicht der Hype-Fisch. Butsch und Knoll hätten wohl am besten gelegen, wenn sie an einen größeren Spieler verkauft hätten. Sie entschieden sich, umzubauen, setzten auf den einzigen Bereich im deutschen Lebensmittelmarkt, der seit der Jahrtausendwende kontinuierlich wächst: nachhaltig erzeugte Nahrung.
Ein befreundeter Pilot brachte Knoll auf die Idee. „Na?“, will Knoll diesen bei einer Begegnung gefragt haben, „wie viel Kerosin hast du heute mal wieder in die Luft geblasen?“ Der Freund frotzelte zurück: „Und du? Welcher Fischart hast du endgültig den Garaus gemacht?“ Schließlich schwemmten schon seinerzeit Studien und Warnungen die Märkte, die Fischwirtschaft gehe so räuberisch mit den Reserven um, dass die Bestände kollabieren. In Knoll wuchs die Idee des nachhaltigen Fangs. Bei einem Treffen der Branche stellte er sie vor. Ziel: eine zu 100 Prozent nachhaltige Fischmarke zu gründen. Fisch ohne Beifang. Fisch, der die Bestände erhält. Fisch, der, wenn er schon gezüchtet ist, ohne Pharmazeutika auskommt. Die Branche antwortete: klappt nie.
Knoll und Butsch stießen ihr Russland-Geschäft dennoch ab und gründeten ihr Unternehmen neu. Statt einfach Fisch zu verkaufen, boten sie den Kunden von Beginn zwei Dinge: das Versprechen, jeden Fisch nachhaltig zu fangen und das auch zu dokumentieren. Und die Auswahl an Bestsellern wie Thunfisch, Lachs, Fischstäbchen und Kabeljau. Die Antwort der beiden an die skeptische Branche: Zwei Millionen Kunden allein im vergangenen Jahr, ein zweistelliges Umsatzwachstum auf mehr als 44 Millionen Euro.
Der Blick aus Knolls glasumrandetem Büro in Friedrichshafen fällt zwar nur auf den Bodensee. Und doch ist Knoll ein Mann für das Meer. Darauf deutet nicht nur der zum Konferenzraum hochgerüstete Schiffscontainer in der Zentrale hin, sondern auch Knolls Reiseplanung: „Ich bin von uns beiden Gründern eher der Typ, der im Winter auf die Malediven fliegt.“ Und weil nicht alle Kunden können, was er kann – nämlich dort die Herkunft seines Thunfischs recht lückenlos kontrollieren –, steht ganz am Anfang von Knolls Neustart eine technische Neuerung für den Lebensmittelbereich.
Deutsche Lebensmittelkonzerne funktionieren in der Regel ja so: Sie geben sehr wenig Geld für den Kauf ihrer Rohstoffe aus, allerdings sehr viel dafür, um zu verschleiern, woher diese kommen. Bei Followfood soll es andersherum sein. Dafür nehme man: das Internet. Und zuverlässige, lang gebundene Zulieferer. Letztere geben nach dem Fang ein, wo dieser erfolgte. Ergänzen Fangmethode und Zeit.
Die Followfish-Datenbank versieht den Fang mit einem Code, der später auf die Verpackung gedruckt wird. Gibt der Kunde diesen Code in seinen Webbrowser ein, kann er per GPS-Ortung die Geschichte seines Fisches erfahren. Auf einmal liegt da kein anonymes Fischstäbchen mehr auf dem Teller, sondern Fisch mit Vergangenheit.
Das System lebt vom Vertrauen der Kunden, darin, dass weder Knolls Mannschaft noch die Fischer vor Ort betrügen. Doch das ist weit mehr als in der Branche üblich. Und so bringt es dem Hersteller sogar Lob von einschlägigen Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, die den Followfish als nahezu einzigen Markenfisch zum Verzehr empfehlen. Mehr als eine halbe Million Euro hat Followfood allein der Aufbau der Technik gekostet. Aber: Ohne das wäre Knoll wohl vom Markt verschwunden.
Breche die Regeln deiner Branche
Die Küche der Followfood-Zentrale gleicht einem gut sortierten Biosupermarkt. Hier Pasta, dort Soßenzutaten, wiederum woanders die eigenen Fischprodukte. „Wir sind schon Nahrungsfreaks“, sagt Knoll. „Wenn hier jemand seine Mittagsverpflegung in den Gemeinschaftskühlschrank legt, muss er damit rechnen, dass wir auf die Etiketten schauen und auch mal diskutieren, was dort enthalten ist.“
Der amerikanische Ökonom Clayton Christensen, der den Begriff Disruption prägte und irgendwann wohl auch inflationierte, sagt über disruptive Unternehmen, dass sie „Anforderungen des Kunden bedienen, die es so vorher nicht gab“. Und der deutsche Silicon-Valley-Pilgerer Christoph Keese sagt: „Der Disruptor optimiert die Vertragsbedingungen des neu entstandenen Geschäfts nicht für sich, sondern für die Kunden. Sie stehen im Mittelpunkt.“
Für Followfood ist der Kühlschrank im Büro der tägliche Beweis, dass sie vom Kunden aus denken. Hier probieren sie, hier denken sie sich in seinen Koch- und Essstil. „Wir wollen anbieten, was der Kunde wirklich will“, sagt Knoll. Was für eine Industrie, in der in den vergangenen Jahrzehnten eher die Kostendrück-Kreativität der Manager als die Konsumwünsche der Kunden den Ausschlag gaben, ungewöhnlich ist.
Nun ist die Ausrichtung am Kundenwunsch einerseits Marketing-Sprech. Andererseits lässt sich der Unterschied dann doch nachzeichnen. Selbst laut dem Verband der Ernährungsindustrie kaufen 27 Prozent der Deutschen nach Nachhaltigkeitskriterien. Aber kaum ein Massenanbieter denkt das zu Ende. Edeka etwa lancierte vor einiger Zeit auch einen handgeangelten Thunfisch. Laut Branchenkreisen stammt der sogar von Followfood. Allerdings lässt Edeka anders als die Friedrichshafener den Fisch nicht auf den Malediven verarbeiten, sondern verfrachtet ihn dafür nach Thailand. Spart zehn Cent pro Dose.
Oder die Sache mit den Zutaten: Wer einfach „bio“ anbieten will, darf dennoch so mancherlei Zusatzstoff in die Ware schmuggeln. Etwa Guarkernmehl. Knoll fand: Den Stoff braucht man nicht. Bis man einen Hersteller gefunden hatte, der das auch umsetzt, brauchte er Monate an Überzeugungsarbeit – und das entsprechende Kleingeld.
Nun ist es bei hauptberuflichen Disruptoren ja mitunter schwierig, zwischen Effekthascherei und Ergebnisorientierung zu unterscheiden. Und auch bei Followfood muss man sagen: Noch besser als Fisch können sie die Verkaufe. Da sitzt etwa in einem Spot, der sich auf YouTube größerer Beliebtheit erfreut, Johannes Oerding neben einem Musiker, der auf einer Okulele in Thunfischform zupft. Oerding schüttelt dazu eine zur Rassel umfunktionierte Thunfischdose und trällert „Einfach nur weg“. Und wie die Weltverbesserer aus dem Silicon Valley formuliert auch Knoll: „Wir träumen davon, dass wir eine der Marken sind, die der ganzen Biobewegung endgültig zum Durchbruch verhelfen.“ Getreu der Formel: Behaupte, du bist groß, dann wirst du groß.
Das funktioniert überraschend oft. Auch, weil gilt, was Christensen formuliert: „Wenn die Etablierten erkennen, welch Wachstumspotenzial die neuen Anbieter anzapfen, ist es meist zu spät.“ Laut Branchenkreisen stellt Followfood heute zehn Prozent des Tiefkühlfischs bei Rewe. Und fast alle großen Fischproduzenten haben heute einen Tracking-Code. Der Markt spielt nun nach Followfoods Regeln. „Hätte der Markt uns nicht nachgeahmt, wäre Followfish heute doppelt so groß. Das ist einerseits natürlich bedauerlich. Andererseits haben wir so viel mehr bewegt, als wir alleine geschafft hätten“, sagt Knoll. Und folgert daraus: Weil die Standards von einst als Alleinstellungsmerkmal nicht mehr reichen, geht der Wandel weiter. Gerade investiert er in Forschung außerhalb des Kerngeschäfts. So haben sie eine Verpackung in Auftrag gegeben, die mit weniger Kunststoff auskommt. Zudem soll Followfood eine richtige Biomarke werden mit mehr als nur Fisch im Angebot.
Irgendwie gleicht Knoll da den Malediven-Männern: erst den Köder werfen – dann abräumen.

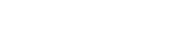 Yahoo Kino
Yahoo Kino 


