Filmkritik: "Swiss Army Man" - Bitte anschnallen, wenn Leichen furzen
Schon die ersten Bilder definieren die Tonart dieses bemerkenswerten wie ungewöhnlichen Films. Da ist ein Mann auf einer einsamen Insel, der sich gerade einen Strick um den Hals gelegt hat und dabei ist, sich zu erhängen. Kurz vor dem entscheidenden Schritt bemerkt er einen menschlichen Körper, der gerade an den Strand gespült ist. Hank (Paul Dano) eilt zur Rettung. Doch die Hoffnung, dass er, der einsame Robinson, vom Schicksal endlich einen Freund, einen Freitag, zugeführt bekommen hat, muss er bald wieder fahren lassen. Der Körper eines Mannes (Daniel Radcliffe) entpuppt sich als Leiche.

Wer an dieser Stelle glaubt, dass die Robinsonade bereits zu Ende ist, bevor sie richtig begonnen hat, der irrt gewaltig. Hank bekommt seinen Gefährten - und zwar in Gestalt eben jener Leiche. Denn die hat nicht nur die sonderbare Eigenschaft, exzessiv zu flatulieren. Was Hank übrigens bald für sich zu nutzen weiß: Die ausströmenden Gase dienen ihm als Wasser-Antrieb, und so reitet er auf dem Toten über die Wellen zum nächsten Festland. Manny, so nennt Hank seinen Begleiter fortan, kann auch reden und verfügt auch sonst über so manches Talent: Er versorgt Hank, einem Brunnen gleich, mit Wasser, mit seinen seinen Armen lässt sich, einer Axt gleich, Holz spalten und sein Penis, nun ja, er dient als Kompass. Manny - darauf spielt der Titel des Films an - ist ein menschliches Schweizer Taschenmesser.
Die Empörten und Begeisterten
“Swiss Army Man” feierte dieses Jahr auf dem Sundance Film Festival Weltpremiere, wo die Tragikomödie bei einigen Zuschauern für Empörung sorgte, bei anderen Begeisterungstürme entfachte. Es ist nicht zu übersehen, woran sich die Empörten gerieben haben. Doch die derbe Komik um eine furzende Leiche mit erigiertem Penis und Dialoge, die um Sex, Pornos und Masturbation kreisen, ist hier nicht zu vergleichen mit Hollywood-Klamauk a lá “Dirty Grandpa” und “Der Diktator”. “Swiss Army Man” reiht sich ein in eine Kinotradition, der sich Filmemacher wie Michel Gondry und Spike Jonze verschrieben haben und deren Wurzeln in der absurden und surrealen Welt eines Samuel Beckett, Luis Buñuel und des frühen Roman Polanski (“Wenn Katelbach kommt…”) liegt.

Man kann den ‘Daniels’, wie sich die Regisseure Daniel Scheinert und Daniel Kwan vermarkten, einiges vorwerfen. Etwa die zuweilen doch etwas holprig geratene Inszenierung. Oder die Tatsache, dass sie mit ihren Ideen und Gags gelegentlich über die Stränge schlagen; dasselbe Manko zeichnet übrigens auch so manchen Spielfilm Gondrys aus: das fehlende Gleichgewicht zwischen Gag und Handlung, Bild und Erzählung. Doch primitv und niveaulos ist ihr Debütfilm mitnichten. Das Derbe und Vulgäre fällt bei ihnen zusammen mit ihrer zugegebenermaßen nicht sonderlich tiefgründigen “Botschaft”, die sie dem Zuschauer auch etwas zu sehr aufdrängen. Die Erkenntnis nämlich, dass das Leben vergeudet wäre, wenn man es nicht frei heraus leben würde. 'If you want to sing out, sing out/ And if you want to be free, be free/ Cause there’s a million things to be’. Diese Zeilen sang Cat Stevens einst in “Harold und Maude” - einer weiteren Groteske übrigens, von der sich die Daniels sicher was abgeschaut haben.
Kinostart: 13. Oktober 2016
[Bilder: Capelight Pictures)

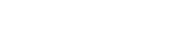 Yahoo Kino
Yahoo Kino 
