Filmkritik: Steve Jobs - Die heilige Kuh der Computerbranche
‘Es wird nicht zur Wahrheit, nur weil du es sagst’, sagt Chrisann Brennan (Katherine Waterston) dem Apple-Guru Steve Jobs (Michael Fassbender mit einer Oscar-reifen Leistung) wenige Minuten vor der Präsentation des Unternehmens NeXT, dem neuen Projekt des Computer-Visionärs. Das Ex-Paar hatte eben einen ihrer heftigen Streits, bei dem es wieder einmal um die gemeinsame Tochter Lisa ging. Jobs warf der Frau gerade vor, das Kind körperlich misshandelt zu haben. Selbst als diese ihm empört versichert, dass die Kleine bei ihrem Ausraster nicht im Zimmer war, beharrt er auf seine Sicht der Dinge. Er sagt es, also war es so.
Mit dem Satz bringt Chrisann den ambivalenten Charakter des Unternehmers auf den Punkt. Steve Jobs ist ein Egomane, wie man ihn auf öffentlichen Bühnen nur selten zu sehen bekommt. Ein selbstherrlicher, größenwahnsinniger und sturer Egozentriker, der das Leben seiner Mitmenschen und -arbeitern zur Hölle machen kann. Der aber auch sanft- und gutmütig sein kann, freundlich und loyal. Wenn, ja, wenn alles und jeder nach seiner Pfeife tanzt.

Aaron Sorkins neuer Versuch
So jedenfalls sieht den 2011 an Krebs verstorbenen, bis heute weltweit verehrten Apple-Gründer Hollywoods derzeit wohl bester Drehbuchautor, Aaron Sorkin. Als 2012 die Nachricht durchsickert, dass der Oscar-Preisträger an einem Drehbuch über Steve Jobs sitze, ist die Überraschung groß. Schließlich ist damals bereits ein groß angekündigtes Filmprojekt über den Branchenrevolutionär im Entstehen begriffen. Das Erstaunen weicht bald einer gespannten Neugier. Denn nicht nur erweist sich “Jobs” mit Ashton Kutcher in der Titelrolle als künstlerisches und finanzielles Fiasko, sodass eine Korrektur notwendig schien. Zweitens hatte Sorkin längst und spätestens mit “The Social Network” bewiesen, dass er das Biopic-Genre beherrscht wie kaum ein zweiter.
Mit “Steve Jobs” wagt sich der Meister also nach Mark Zuckerberg an eine weitere gewichtige Persönlichkeit des Internet-Zeitalters. Und schafft dabei das Kunststück, dass er, der Autor, angesichts eines illustren Darsteller-Ensembles und eines Oscar-gekrönten Regisseurs der eigentliche Star des Films ist. Der Grund ist nicht nur, dass Sorkin einmal mehr eine Vorlage verfasst hat, das vor vielschichtigen und temporeichen Dialogen nur so strotzt, sondern sich auch für ein dramaturgisches Konzept entschieden hat, das im Kontext von Hollywoods Biopic-Wahn so bahnbrechend ist wie Jobs’ Erfindungen in der Computerbranche.

Bühne von Begegnungen
Weil es ihm nicht um das Leben des Visionärs ging oder dessen Aufstieg und Fall und Wiederaufstieg als Unternehmer, sondern um die Freilegung eines komplexen Charakters, greift Sorkin drei entscheidende Phasen aus Jobs’ Karriere heraus. Er gliedert die Erzählung in drei klar von einander getrennte Blöcke, die jeweils hinter den Kulissen einer großen Produkt-Präsentation angesiedelt sind: der Einführung des Personal Computers Macintosh im Jahr 1984, der Präsentation von NeXT vier Jahre später und der Vorstellung des iMac 1998. Die drei großen Teile unterteilt er wiederum in mehrere kleinere Blöcke, die aus Begegnungen zwischen Jobs und Persönlichkeiten aus dem privaten und beruflichen Umfeld des Unternehmers bestehen.
Diese einfache Struktur erweist sich als perfektes Mittel für Sorkins Anliegen, dem Menschen Jobs nahezukommen. Und was für ein Bild eines Mannes entsteht da nach und nach vor dem Auge des Zuschauers? Wenn Ex-Freundin Chrisann, Tochter Lisa, ehemalige und aktuelle Kollegen wie John Sculley (Jeff Daniels), Joanna Hoffman (Kate Winslet), Andy Hertzfeld (Michael Stuhlbarg) und Steve Wozniak (Seth Rogen) jeweils auf Jobs treffen, dann gleichen diese Begegnungen einer Audienz bei einem Auserwählten. Und wenn seine Heiligkeit bei den Wortgefechten Sätze von sich gibt wie: 'In der Geschichte der Menschheit gab es zwei bedeutende Ereignisse, der Angriff der Alliierten während des Zweiten Weltkrieges und die Einführung des Macintosh’, oder: 'Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert und wird von den Menschen dennoch geliebt, nur weil er Bäume erschaffen hat’, oder: Er werde eine Kerbe ins Universum hinterlassen - dann sagt das viel über die Selbstwahrnehmung dieses sich gottgleich gebärdenden Mannes aus.

Dirigent eines Orchesters
Wie verzerrt dieses Selbstbild übrigens ist, das wird Jobs gar nicht bewusst. Selbst dann nicht, wenn er eine weitaus treffendere Definition seiner Position im Apple-Konzern gibt. 'Was kannst du eigentlich?’, fragt ihn einmal sein ehemaliger Partner Wozniak. 'Du bist weder Informatiker, noch Techniker, noch Designer. Was tust du?’ Jobs Antwort: 'Ich bin der Dirigent, der das Orchester leitet’. Eben: ein Dirigent, der auf Grundlage einer geistigen Schöpfung erst kreativ wird. Wenn man schon einen Vergleich bemühen will, dann ist Jobs allenfalls der Papst, der zwischen Gott und Mensch vermittelt, nicht Gott selbst.
So sehr Sorkin und sein kongenialer Regisseur Danny Boyle, der die Drehbuchvorlage filmisch bravourös interpretiert, ihre Hauptfigur demontieren, so sehr sind sie am Ende um Ehrenrettung dieser heiligen Kuh der Computerbranche bemüht. Eine weitere Auseinandersetzung mit Tochter Lisa legt des Pudels Kern schließlich frei. 'Ich bin eben schlecht programmiert’, sagt er der jungen Frau reumütig, die ihm seine jahrelange Abwesenheit als Vater vorwirft. Es ist der große Einschnitt im Leben des emotional unreifen Mannes, der auf der Ebene der Dramaturgie aber der einzige Wermutstropfen in einem ansonsten großartigen Film ist. Sorkin nimmt seinen Antihelden erst mühsam auseinander, dann baut er ihn wieder sorgsam zusammen. Der Fehler im Programm wird behoben, während die klassische Erzählung zu ihrem Recht kommt: Das Ungleichgewicht wird wiederhergestellt, der Mensch findet zu sich selbst.
Kinostart: 12. November 2015
Autor: Willy Flemmer
(Bilder: © 2015 Universal Pictures International)

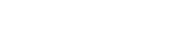 Yahoo Kino
Yahoo Kino 
