Filmkritik: Nicole Kidman kann 'Destroyer' auch nicht retten

Nicole Kidman spielt in “Destroyer” eine Polizistin, die an sich selbst zugrunde geht. Mehr als die überzeugende Leistung der Oscar-Preisträgerin hat das prätentiöse Polizeidrama nicht zu bieten.
Diese Frau ist gezeichnet vom Leben. Dass in der Vergangenheit der strauchelnden Polizistin etwas schief gegangen ist, das entfaltet die US-Filmemacherin Karyn Kusama (“Aeon Flux”) in “Destroyer” nach und nach. Auch dass ihre Misere selbstverschuldet ist, wird allmählich deutlich. Was allerdings von Anfang an bis zum Schluss dieses überlangen und quälend langweiligen Films auf penetrante Weise dem Zuschauer unter die Nase gerieben wird, ist die Tatsache, dass Erin Bell ihre Schuld nie überwinden konnte. Statt sich damit auseinanderzusetzen, hat sie sich gehen lassen – um sich jahrelang, seit sehr vielen Jahren sogar, Tag ein und Tag aus in ihrem Schmerz zu suhlen. Leben in Pein muss auch etwas erhaben Schönes sein. Ist das die Aussage des Films? Oder geht es hier eher darum, dass psychisch lädierte Menschen ein besonders filmtaugliches Motiv abgeben?
Der Verdacht liegt tatsächlich nahe, dass mit dem Motiv des gebrochenen Charakters ein Film aufgewertet werden sollte, an dem darüber hinaus weder substantiell noch erzählerisch viel dran ist. Dazu passt auch die Darstellung von Erin Bells Äußerem. Was im Innern kaputt ist, zeigt sich nach außen hin verwahrlost. Hier kommen nicht nur die (drei) Maskenbildner von “Destroyer” ins Spiel, sondern auch das Spiel von Hauptdarstellerin Nicole Kidman zum Zug. Sie alle neigen zu Exzess und Stilisierung. Kidman spielt die Polizistin mit einem großen Mut zur Hässlichkeit. Und das bei aller Übertreibung durchaus gekonnt. Ihre Erin Bell hätte man eher obdachlos auf der Straße vermutet, nicht in den Räumlichkeiten einer Polizeibehörde. Abgemagert torkelt die Polizistin von A nach B, das Gesicht ist eingefallen, ihre Augenhöhlen sitzen tief, die Haare sind zerzaust und ihre Klamotten sehen aus, als hätte sie sie seit Jahren weder gewaschen noch gewechselt.
Kidmans vergebliche Mühe
Kidman beweist, dass sie den Oscar, den sie für “The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit” erhalten hat, wert ist. Wie schon die Filmbiographie über Virginia Woolf trägt sie auch hier den Film. Dort war die Herausforderung aber weitaus größer, weil die Last viel schwerer war – auch eingedenk der Tatsache, dass sie sich gegen Schauspielikonen wie Meryl Streep und Julianne Moore hatte behaupten müssen. Hier spielt Kidman weder gegen eine große Konkurrenz an, noch wirkt sie in einem großen Werk mit. “Destroyer” tut allenfalls schwergewichtig. Der Film ist prätentiös und – nicht nur mit seiner Hauptfigur – darauf aus, die Zuschauer und vielleicht das eine oder andere Preisgremium zu beeindrucken. Die Oscar-Academy zumindest ließ sich nicht blenden. Kidman war für den Darstellerpreis dieses Jahr nicht einmal nominiert. An ihr lag es nicht. Der Schuss ging vielmehr vielleicht nach hinten los: Ihre Darstellung hat “Destroyer” nicht retten können, dafür dürfte der schwache Film ihre starke Leistung geschmälert haben.

Dass diese Erin Bell überhaupt so lange als Polizistin arbeiten konnte, kann man als kleines Wunder verbuchen. Dabei geht es in “Destroyer” alles andere als fantastisch zu. Der Film will vielmehr in den Sumpf der Unterwelt eintauchen und zeigen, welche Auswirkungen Verbrechen und Schuld auf die Psyche eines Menschen haben kann. Um das zu erreichen, wagen sich Kusama und die Drehbuchautoren Phil Hay und Matt Manfredi auf zwei Zeitebenen, die sie nicht nur erzählerisch, sondern auch kausal miteinander verschränken. Die Erin Bell von heute ist das Ergebnis der Erin Bell von damals. Heute wird die Polizistin zu einem Tatort gerufen. Das Verbrechen: Mord und Totschlag. Anhand einiger Indizien erkennt Bell, dass das Opfer im Zusammenhang mit jenem Gangster steht, gegen den sie damals, vor 17 Jahren mit ihrem Partner Chris (Sebastian Stan) verdeckt ermittelt hatte. Der Undercover-Einsatz ging – gelinde ausgedrückt – nicht gut aus. Die Polizisten waren nicht nur allzu tief in das kriminelle Milieu um Silas (Toby Kebbell) eingetaucht. Sie hatten auch einige falsche Entscheidungen getroffen, von denen eine so schwerwiegende Folgen hatte, dass Bell bis heute noch daran knabbert.
In der festen Absicht, den totgeglaubten Silas endlich dingfest zu machen, beginnt Bell mit den Recherchen. Mit der konventionellen Dramaturgie eines Kriminalfilms wollen sich Kusama und die Drehbuchautoren in der Folge aber nicht begnügen. Außerdem gilt es doch, die Neugier des Zuschauer zu befriedigen: Wie wurde aus Erin Bell der kaputte Mensch, der sie heute ist? Und so lassen sie die Ermittlung, die die Polizistin von Zeuge über Komplizen zum Haupttäter führen soll, immer wieder durch Rückblenden unterbrechen. Dabei beschleicht einen auch hier der Verdacht, dass mit dieser klassischen Erzähltechnik Substanz suggeriert werden und etwas Bewegung in die allzu langatmige Erzählung gebracht werden sollte. In beiden Fällen sabotiert Kusama jedoch sich selbst.
Zuschauerblendung mit bleiernen Rückblenden
Denn ihr Gebrauch der Rückblende ist konventionell bis hin zu einfallslos. Den Sprung in die Vergangenheit leitet sie gerne mit einer Einstellung auf dem Gesicht der Polizistin ein, und genau dort landet sie wieder, wenn die Erzählbewegung von der Vergangenheit zurück in die Gegenwart führt. Klischierter geht es nicht. Und statt die Erzählung vorwärts zu drängen, kleben die allzu inflationär gebrauchten Rückblenden wie Bleiklumpen an ihr. Vor allem scheitern sie in ihren wichtigsten Aufgaben. Sie schaffen es weder den ursächlichen Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart, von Ursache und Folge hinreichend herauszuarbeiten, noch auch nur Ansatzweise das Damals und das Heute zu charakterisieren. Statt eines plastischen Bildes von Milieu und Charakter ist ein diffuses Etwas entstanden, das sich im Kopf des Zuschauers zu keinem Ganzen zusammenfügen will.

Man kann “Destroyer” weiter hinsichtlich seiner Blendungstaktik abklopfen. Kusama, Hay und Mandredi hatten offenbar die Absicht, mit Erin Bell eine Art weiblichen Bad Lieutenant zu erschaffen. Mehr noch als an Abel Ferraras gleichnamigen Polizeifilm erinnert ihr Film an die gesellschaftskritischen Dramen und Polizeifilme der 1970er Jahre. Während die Taxi Drivers von New York aber an der Welt zugrunde gehen, in der sie leben, und während die Serpicos gegen die moralische Verkommenheit von Gesellschaft und Mensch ankämpfen, dreht sich die Polizistin Bell einzig um sich selbst. Kusama und Co. wollten kein Gesellschaftspanorama entwerfen, sie hatten eine Charakterstudie im Sinn. Das war ihr gutes Recht, aber auch ihre Schuld, dass sie daran gescheitert sind. Es ist schon ein naives Menschenbild, das sie haben. Bell ist selbstverschuldet in ein tiefes Loch gefallen, doch sich daraus einfach nicht befreien können? Das können sie einem nicht weißmachen. In einer Szene befragt Bell einen zwielichtigen Anwalt, der angesichts des Häufleins Elend, das er vor sich hat, in seiner ganzen Arroganz zurückfragt: “Wissen Sie, was Gewinner ausmacht? Sie kämpfen auch nach Niederlagen weiter.” Recht hat er irgendwie – als genervter Zuschauer möchte man jedenfalls der Hauptfigur nur zu gerne zurufen: Gute Frau, sie haben einen Fehler gemacht. Aber ist es nach 17 Jahren nicht langsam an der Zeit, sich endlich am Riemen zu reißen?

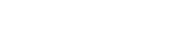 Yahoo Kino
Yahoo Kino 
