Das dunkle Vermächtnis des Steve Jobs
Dave McClure hat aufgegeben. Zuerst wollte er von gar nichts wissen. Dann versuchte er alles zu erklären und die „Umstände“, die es mit sich brachten. Dann zog er sich „aus dem Tagesgeschäft“ zurück und verkündete, er habe es verdient, ein „Ekel“ genannt zu werden. Am Montag gab er dann klein bei. In einer internen E-Mail verkündete er seinen kompletten Rücktritt als General Partner von 500 Startups, einem der renommiertesten Inkubatoren des Silicon Valley.
Das Unternehmen hatte er mitgegründet. Er übernahm am Ende doch noch die Verantwortung für Anschuldigungen, er habe Unternehmerinnen, die Finanzierungen suchten, und weibliche Bewerber für Jobs im Unternehmen zumindest sexuell zweideutige Angebote gemacht. Nicht in seiner Freizeit, sondern während verhandelt wurde.
Wer nach dem spektakulären Rausschmiss von Uber-CEO Travis Kalanick und zwanzig weiteren Uber-Mitarbeitern nach noch geglaubt hatte, die Sache mit der Diskriminierung von Frauen sei damit vom Tisch und das Sodom und Gomorra der Tech-Industrie trockengelegt, dem ist seit vergangener Woche klargeworden, dass dem nicht so ist. Die Investigativ-Plattform „The Information“ und die New York Times gruben nicht nur die Geschichten um Dave McClure aus, auch ein anderer Prominenter der Risikokapitalszene geriet in Verruf. Chris Sacca, bekannt aus der TV-Reality-Show „Shark Tank“, gestand in zwei Blogposts, dass auch er Teil dieser „Bro-Kultur“, der allgegenwärtigen Art von digitaler männlicher Bruderschaft, gewesen sei.
Als ersten der aktuellen Welle hatte es Justin Caldbeck erwischt, einst bei Bain Capital und Lightspeed Ventures. Der Gründer von Binary Capital hat laut „The Information“ mindestens sechs Frauen belästigt. Er verließ Binary Capital, um zu retten, was noch zu retten war.
Es sind zwei große Fragen, die das Valley jetzt umtreiben. Die eine ist, wie schutzbedürftig Unternehmer und Gründer von Start-ups eigentlich sind. Alle sprechen über Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page oder Travis Kalanick. Diese Männer sind superreich, haben gewaltige Egos und sind, abgesehen von Kalanick, auf der Höhe der Macht. Aber VC-Investoren oder Seed-Investoren der ersten Stunde treffen auf junge, verwundbare Gründer. Sie sind nicht alle mit reichen Eltern gesegnet, sondern haben oft große Ideen im Kopf, aber große Schulden auf der Kreditkarte. Das Machtgefälle könnte nicht größer sein, oder wie McClure es ausdrückte, er habe bei solchen Gelegenheiten einfach Frauen in „unangemessene“ Situationen gebracht und eigensüchtig das Machtgefälle ausgenutzt.
In Unternehmen oder Organisationen gibt es Personalabteilungen oder Beschwerdefälle für solche Fälle. Aber bei Gründern und Finanziers? Soll vielleicht die Notenbank Fed die Überwachung übernehmen? Linkedin-Gründer Reid Hoffman schlägt so etwas wie eine freiwillige Selbstkontrolle der Branche vor, quasi eine übergeordnete Silicon-Valley-Personalabteilung, die in solchen Fällen einschreiten solle. Aber wie praktikabel das ist, lässt er offen.
Die goldene Aura des Apple-Gründers
Die zweite Frage ist, wie weit dieses Problem schlicht hausgemacht ist. Während es schon früher immer mal Firmenbosse gab, die für die physische oder psychische Misshandlung ihrer männlichen und weiblichen Angestellten berüchtigt waren, scheint die Digitalindustrie die Vergötterung der Widerlinge zum System erhoben zu haben.
Und es begann mit Steve Jobs. Vergöttert und verehrt von Generation junger Cyber-Unternehmer wurde der Apple-Gründer zum lebenden Beweis hochstilisiert, dass man ein Arschloch sein darf oder sogar muss, wenn man die Welt verändern will. Die Erzählungen über seine Auftritte und Demütigungen, über Tiraden, die über Mitarbeiter niedergingen, sein Verhalten gegenüber seiner engsten Familie, sie sind alle bekannt. Und doch umgibt sie so etwas wie eine göttliche Aura. Mitarbeiter, die er übelst schikaniert und gedemütigt habe, seine „über sich hinausgewachsen“, hätten Dinge vollbracht, die sie „nie für möglich gehalten hätten“.
Die Biografien über Steve Jobs sind die neuen Managementbücher, die jedem Travis Kalanick eine Entschuldigung für unerträgliches und bösartiges Verhalten versprechen. So wie die Diskussion des Uber-Chefs mit einem seiner Fahrer, die auf Youtube die Runde machte. Kalanick bürstete die Kritik des Mannes einfach mit der Bemerkung ab, es gebe halt immer Menschen, die keine Verantwortung für ihr Leben (und ihre Fehler) übernehmen wollten. Danach versprach er, er werde sich bessern. Wie immer. Kurz darauf ergaben interne Untersuchungen eine geduldete Arbeitsatmosphäre, bei der sich besonders gute Mitarbeiter einfach alles rausnehmen konnten, bis hin zur sexuellen Belästigung, was dann von der Personalabteilung diskret geregelt wurde.
Die Digitalindustrie im Silicon Valley hat noch viel nachzuholen. Solange das Streben nach Perfektion nur mit Aggressivität und Bösartigkeit gleichgesetzt wird, wird sich das Macho-Unternehmertum niemals ändern und irgendwann untergehen. Das merken langsam auch die Investoren, die vor dem Trümmerhaufen Uber stehen. Ob dieses Unternehmen überhaupt noch in seiner jetzigen Form und der Bewertung von 70 Milliarden Dollar zu retten ist, kann dahingestellt sein. Für andere könnte es noch nicht zu spät sein.
Immer dienstags schreiben Britta Weddeling und Axel Postinett, Korrespondenten des Handelsblatts im Silicon Valley, über neue Trends und den digitalen Zeitgeist im Tal der Nerds.

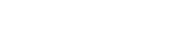 Yahoo Kino
Yahoo Kino 

