Wie deutsche Unternehmen Trumps Handelskrieg ausweichen
Manfred Lindloff ist ein erfolgreicher Beamter. Er kennt seine Vorschriften und Gesetze nicht nur, nein, die Beziehung geht tiefer. „Meine Bibel“ nennt er den Unionszollkodex, das Gesetzbuch über die Grenztarife in Europa. Und wenn Lindloff, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Waltershof, mitten im Hamburger Hafen, daraus predigt, dann klingt das so: „Im Kodex steht, dass wir Waren unverzüglich abzufertigen haben. Ob das dann 12, 24 oder 72 Stunden sind, steht da nicht.“ Spricht es, die Arme akkurat verschränkt auf der grünen Uniformjacke, und blickt aus seinem Eckbüro in Richtung Unendlichkeit, hinweg über die Kulisse der Globalisierung. Rechts die Köhlbrandbrücke, links die Terminals, an denen sich die bunten Container stapeln.
Drei Stockwerke weiter unten zeigt das Wort des Herrn derweil seine Wirkung. In einem engen Flur mit einer Handvoll Sitzplätze warten die Lastwagenfahrer, dass eines der Lämpchen unter der Decke endlich auf Grün umschaltet. Grün bedeutet Abfertigung. Kann aber dauern. Das beweisen die hängenden Gesichter, die roten Verbotsschilder, die Sitzen auf den Treppenstufen untersagen – und die Kommentare im Internet: „Langsamer können nur Schnecken und Faultiere“, schreibt einer.
Der zähe Alltag im Zollamt Waltershof könnte schon bald zum neuen Pulsschlag des Welthandels werden. Heute wird nur noch ein Bruchteil aller Waren, die nach Deutschland eingeführt werden, auf diese Weise verzollt, der Großteil passiert längst elektronisch. Doch seit US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Stahl und Alu verkündet hat, mit Abgaben auf deutsche Autos droht und vom Handelskrieg spricht, sind Diplomaten und Politiker aus den Industrieländern in Aufruhr. Sie fürchten einen Rückfall in Zeiten der Kleinstaaterei, wo hinter jeder Hafenmauer ein Schlagbaum wartet und vor jeder Grenze eine Warteschlange.
Ein solcher Handelskrieg, ist sich das ifo Institut jetzt schon sicher, „kennt nur Verlierer“. Die EU-Kommission plant dennoch den Gegenschlag: Zölle auf Erdnussbutter und Orangen, auf US-Whiskey und Harley-Davidsons. Nur von denen, die dieser Krieg eigentlich treffen müsste, ist erstaunlich wenig zu hören. Die Unternehmen lassen zwar ihre Lobbyisten mahnen, den großen Aufschrei aber vermeiden sie. Klar: Wer zugibt, dass das eigene Haus darunter leidet, den erwischt es garantiert als Ersten. Aber selbst hinter vorgehaltener Hand bleiben die Konzernvertreter ruhig. Wir finden da schon einen Weg, flüstern sie dann.
Zölle, soll das heißen, sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Die Unternehmer von heute jedenfalls schrecken sie kaum mehr. Dafür sind sie viel zu gut beraten, von einer Heerschar an Anwälten und Consultants, die ihnen erzählen: Handelskrieg ist halb so schlimm – wir helfen da durch. Anti-Zoll-Berater – eine Profession, die es schon gar nicht mehr geben dürfte, die nun eine ungeahnte Konjunktur erlebt – dank Trump.
Zölle. Bislang konnte Claudia Schmucker bei diesem Wort nur müde lächeln. Die Dame ist Handelsexpertin bei der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Dort leitet sie seit fast 15 Jahren das Programm Globalisierung und Weltwirtschaft. Und bislang bedeutete das vor allem: Handelsabkommen bewerten, Vorschriften anprangern, Einfuhrquoten beobachten, also sogenannte nicht tarifäre Handelshemmnisse. „Zölle“, sagt Schmucker, seien im transatlantischen Handel „für die Realwirtschaft nicht mehr von besonderer Bedeutung“.
Wer Schmucker aber dieser Tage spricht, der hört viel von den indirekten Folgen des Zollwettlaufs: Verschlechterung des Handelsklimas, Umleitung der Rohstoffe, am Ende vielleicht das Ende der Welthandelsorganisation WTO. Die angekündigten Einfuhrabgaben selbst, sagt Schmucker, „haben jedoch nur moderate Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft“. Interessanter ist da schon die Nebenwirkung: der nie gekannte Zulauf, den Zolloptimierer erleben.
"Vertrieb und Zoll waren natürliche Feinde"
Ganz am Anfang dieses Weges stehen die Unternehmer, die sich an einem sonnigen Märztag im Terrassensaal der IHK Mönchengladbach versammelt haben. „Zoll für Manager“ heißt die Veranstaltung, und mit knapp 30 Leuten ist der Raum voll besetzt. Vorn sitzen zwei ehemalige Zöllner, die heute ihr Geld bei einer dieser amerikanischen Beratungsgesellschaften verdienen, die gegen nicht unerhebliche Honorare von Unternehmenssteuern bis zu Personalkosten fast alles optimieren. Den Leuten hier wollen sie erklären, wie sie den Status als „zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“ bekommen. Als solche kämen sie schneller und günstiger durch den Zoll. Aber die Berater müssen dann doch ein paar Schritte weiter vorne anfangen. „Sie sprechen hier immer von Zollbeauftragten“, meldet sich eine Unternehmerin der zupackenden Sorte zu Wort. „Aber wer soll das in einem kleinen Unternehmen bitte sein, wo es unter dem Chef keine Führungskräfte gibt?“ Das, sagt die höfliche Exbeamtin, sei tatsächlich eine „unglückliche Situation“.
"Zoll ist toll"
Jahrzehntelang spielten Zölle in Unternehmen eine ähnliche Rolle wie Frost am Bau. Verteuert und verzögert das Geschäft, lässt sich aber nicht vermeiden. „Traditionell“, sagt die Zollberaterin, „waren der Vertrieb und der Zoll die natürlichen Feinde.“ Doch mit jeder Zollunion wuchs der globale Handel, mit jedem Freihandelsabkommen Fabriken in neuen Ländern. Und jedes Mal wurde auch das internationale Zollrecht ein bisschen komplizierter – was bedeutet, dass es mehr Spielräume gibt.
Spielräume. Eben da beginnt für Thomas Gau das Geschäft. Wer ihm zuhört, der merkt sofort, dass die Zeiten, in denen Vertrieb und Zoll Feinde waren, lange her sein müssen. Sein Wahlspruch, erläutert Gau ohne den Anflug von Ironie, laute „Zoll ist toll“. Beim internationalen Logistikdienstleister Hermes verantwortet er die Sparte Supply Chain Solutions, darf sich Head of Customs Solutions nennen, was nichts anderes bedeutet, als dass Gau in den vergangenen Jahren ein völlig neues Geschäftsfeld erschlossen hat. Jahrelang hatte das Unternehmen selbst Zollberater engagiert. Irgendwann, sagt Gau, habe man sich gedacht: Warum machen wir das nicht selbst – und bieten es auch den Kunden an? Und so fährt Gau seit zwei Jahren durch die Lande, immer eine „sales lead“ in der Tasche: eine Idee, wo man Zölle sparen könnte. Verraten kann er die nicht, nur so viel: „Aktive Veredelung ist eine wichtige Methoden, um Zollkosten zu optimieren“, das sei ein echter „Moneymaker“.
Wenn man ihm zuhört, klingt es, als wäre Zollrecht ein bisschen so wie Schach: wenige klare Regeln und unendliche Möglichkeiten. Zunächst ist die Sache so eindeutig, wie Trump sie jetzt darstellt. Wer Stahl in die USA einführt, der zahlt dafür den festgesetzten Zoll. In der Summe der realen Wirtschaftstransaktionen aber sind diese Fälle in der Minderheit. Die meisten gehandelten Waren sind Vorprodukte, also Güter, die später noch zu etwas anderem verarbeitet werden. Das aber bedeutet: Wenn ein Unternehmen eine Ware in ein Land einführt, dann will es keineswegs exakt diese Ware später auch verkaufen oder unverändert in ein anderes Land exportieren. Und hier kommt die aktive Veredelung ins Spiel.
„Grundsätzlich gilt im Zollrecht: Je weiter eine Ware verarbeitet ist, desto höher ist der Zollsatz“, sagt Marian Niestedt, Zollrechtsexperte bei der Kanzlei Graf von Westphalen. So wollen es die Staaten der heimischen Wirtschaft erleichtern, sich mit Rohstoffen einzudecken und die Produktion im Land anzusiedeln. Und genau diesen Wunsch nutzt Hermes-Mann Gau, um aus einem Zoll einen Moneymaker zu machen. Dabei geht es darum, Gütern zu einem sogenannten „Tarifsprung“ zu verhelfen. Ein importiertes Gut, das danach wieder exportiert werden soll, muss so weit bearbeitet werden, dass es zollrechtlich in eine neue Kategorie fällt. Wenn also zum Beispiel aus Zucker und Früchten Marmelade wird, entfallen die Importzölle für die Vorprodukte. Je besser Unternehmen diese Tarifsprünge kennen und je mehr Schritte die internationale Lieferkette des Unternehmens hat, desto besser geht das. Wenn es dann noch Freihandelsabkommen gebe, die man nutzen könne, ließe sich für fast jedes Produkt eine zollrechtlich günstige Lösung finden. „Gerade die Vorteile von Ursprungsregeln bleiben leider oft ungenutzt.“
Der Weg zur ewigen Zollglückseligkeit
Wie sehr sich die Kenntnis dieser Regeln auszahlt, weiß Sven-Boris Brunner besonders gut – schließlich sind sie der Kern seines Geschäfts. Brunner hat sich jahrelang im Auftrag eines Logistikkonzerns um die komplizierten Länder gekümmert: Iran, Russland, Aserbaidschan, dort, wo der internationale Handel Ecken und Kanten zeigt. Unterschiedliche Sicherheitsstandards, überforderte Bürokraten und – natürlich – Zölle. „Wer beim Thema Zoll wirklich Geld sparen will, der muss darüber nachdenken, wenn er seine Lieferkette aufsetzt“, sagt Brunner, inzwischen Chef seiner eigenen Exportberatung ICS, „im Nachhinein lassen sich oft nur noch kleine Korrekturen vornehmen.“ Dieser Appell fruchtet offenbar: Zuletzt hat er einen deutschen Autokonzern bei der Standortauswahl beraten – die sich dann nach dem günstigsten Zollsatz richtete.
Blaupause für Trump
Freihandelsabkommen sind dabei so etwas wie die Königsdisziplin: Rund 200 gibt es inzwischen weltweit, aber keines gleicht dem anderen. So unterhält die Europäische Union etwa mit der Türkei eine echte Zollunion, was bedeutet, dass Waren die in Deutschland einmal verzollt wurden, zollfrei in die Türkei exportiert werden können. Zugleich gilt zwischen der EU und Mexiko ein Freihandelsabkommen mit Ursprungsregeln: Wenn ein Produkt zu einem relevanten Teil in Mexiko hergestellt wird, darf es zollfrei in die EU importiert werden. Kombiniert man die beiden Abkommen, dann lässt sich jedes Gut kostenfrei aus Mexiko in die Türkei bringen. Ähnliche Wege finden sich zwischen vielen Ländern der Erde. „In je mehr Ländern ein Unternehmen Werke hat, desto besser lassen sich dann auch die Ursprungsregeln nutzen“, sagt Zollanwalt Niestedt.
Aus abstrakten Regeln werden so plötzlich konkrete Planspiele. Darüber etwa, wie sich die US-Strafzölle umgehen lassen. Ein deutscher Autohersteller beispielsweise, der Werke in den USA und Mexiko betreibt und in beiden importierten Stahl aus Deutschland einsetzt, könnte – um Trumps neuen US-Strafzoll zu sparen – den Stahl nur noch an sein mexikanisches Werk liefern und dort veredeln oder mit mexikanischen Vorprodukten kombinieren. Alles zusammen könnte dann zollfrei in die USA eingeführt werden. Was klingt wie ein Gedankenspiel wird derzeit in einem deutschen Konzern geplant. Nur geredet wird darüber nicht so gerne. „Wir wären verrückt, wenn ich das öffentlich bestätigen würde“, sagt ein Sprecher. „Dann würden wir Trump die Blaupause liefern, wie er uns treffen könnte.“
Zu einer wahren Meisterschaft in der Disziplin der Zolloptimierung haben es in den vergangenen Jahren die chinesischen Stahlexporteure gebracht. Ausgerechnet jene Branche also, auf die es der US-Präsident eigentlich abgesehen hat. In einer Studie untersuchten jüngst zwei Forscher der Remnin-Universität in Peking, wie sich die Stahlexporte Chinas nach einer Erhöhung der Zölle veränderten. Als die USA die Zölle das letzte Mal drastisch anhoben, sanken zwar die Importe aus China direkt – dafür stiegen die Importe aus Vietnam massiv an, während zugleich die Exporte Chinas dorthin stiegen. Europas Stahlbranche erlebte das Gleiche mit dem Umweg über Südkorea.
Vielleicht ahnt inzwischen auch Trump, dass die Sache mit dem Handelskrieg doch nicht so einfach ist, wie gedacht. Dass sich am Ende immer ein Optimierer finden wird, der den Tick smarter ist als scheinbar undurchlässige Zollmauern. Er erwarte, sagte Trump jedenfalls am Ende seiner Ankündigung, dass die beiden vom Zoll ausgenommenen Nachbarländer Kanada und Mexiko „aktiv werden, um die Weiterverschiffung von Waren in die USA zu verhindern“.
Große Konzerne beginnen deshalb sofort, sich nach Alternativen umzusehen. Für kleine und mittelständische Unternehmen steckt darin eine bittere Wahrheit: „Wie viel Zoll ein Unternehmen zahlt, ergibt sich meist allein aus seiner Größe“, sagt Michael Schäfer, der beim Berater Deloitte für den Bereich Zoll verantwortlich ist. Denn Tarifoptimierung ist vor allem eine Frage von Geld – und Kapazität. Und so gilt für die Zölle am Ende das Gleiche wie für Steuern: Je kleiner das Unternehmen, desto geringer die Chance, davonzukommen. Und die kleinsten in diesem großen Spiel, das sind zweifellos die Lastwagenfahrer am Schalter in Waltershof. Nur das Schimpfen, das kann ihnen keiner nehmen.

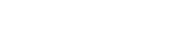 Yahoo Kino
Yahoo Kino 


