Ein Containerdorf für angehende Millionäre
Die Arbeitersiedlungen mit ihren kleinen Backsteinhäuschen wurden Anfang des 19. Jahrhunderts zum unverwechselbaren Markenzeichen der boomenden Kohle- und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. Zu Beginn der Industrialisierung gab es an Ruhr und Emscher noch keine bedeutenden Städte. Die Arbeiter mussten nahe der Zechen untergebracht werden. Weil es keinen Wohnraum gab, wurde er geschaffen.
Die Zechensiedlungen der Kumpel des 21. Jahrhunderts entstehen heute im mondänen Mountain View. Hier, wo einfachste Einfamilienhäuser nicht mehr unter einer Million Dollar zu bekommen sind, schuftet das Software-Prekariat in den gigantischen Big-Data-Zechen von Google oder Facebook, mit kostenlosen Snacks und privaten Fitnesscenter. Aber das Grundproblem hat sich seit 1900 nicht verändert. Wo soll ich wohnen?
Google und andere Hightech-Unternehmen locken die Daten-Kumpel aus aller Welt magisch an. Die kommen mit völlig falschen Vorstellungen in Tal der Verheißungen. Wer mit Mitte 20 in die Data-Gruben zur 12-Stunden-Schicht einfährt, der bringt im Jahr schnell 150.000 Dollar oder mehr nach Hause und wähnt sich reich. Aber das Zuhause ist dann ein Studioappartement in San Francisco in der Größe eines überdimensionierten Tiefgaragenstellplatzes und kostet 2500 Dollar pro Monat. Wer den Luxus einer Küche und eines kleinen Schlafzimmers haben will, muss in mittlerer Lage noch mal 1000 Dollar drauflegen, um in einer lauten Straße in einem 100 Jahre alten Haus und Einfachverglasung zu wohnen.
Die Situation ist so angespannt, dass eine vierköpfige Familie mit einem Jahreseinkommen unter 150.000 Dollar offiziell als arm eingestuft wird. Mitarbeiter von Facebook, wo schon ein Praktikant 8000 Dollar im Monat bekommt, sollen sich in einem offenen Brief an Mark Zuckerberg gewandt und um Hilfe gebeten haben. Sie können sich den Boom, den sie entfacht haben, einfach nicht mehr leisten.
Besonders hart trifft es die einfachen Zuarbeiter. Eine Mitarbeiterin aus dem Customer Support Team der Bewertungsplattform Yelp/Eat 24 schrieb unlängst in einem offenen Brief an ihren CEO, dass sie von einem Leben träumen würde, ohne jeden Abend in der Badewanne zu weinen, oder an manchen Tagen kein Geld zu haben, um eine U-Bahnkarte kaufen zu können. Andere Mitarbeiter würden an Anschlagbrettern im Unternehmen Bitten um Spenden veröffentlichen, damit sie ihre Miete bezahlen könnten. Viele nähmen massenweise die Snacks aus dem Unternehmen mit nach Hause, weil sie sonst nichts kaufen könnten. Das Ergebnis: Sie wurde gefeuert. Allerdings aus Gründen, die laut Unternehmen nichts mit dem offenen Brief vom Tag zuvor zu tun hatten.
Ein Fahrer von Apple, der die Data-Kumpel jeden Tag zur Mine nach Cupertino und zurück kutschiert, machte Furore, als bekannt wurde, dass er nachts im Bus schläft, im Fitnesscenter duscht, und nur am Wochenende zur Familie kann, die weit entfernt wohnt. Für mehr reicht das Geld nicht mehr. Die Diskussion um das unbezahlbare Leben im Valley hat mittlerweile alle erreicht. Denn als die Armen aus dem Valley vertrieben waren, blieben die Mieten nicht niedrig, sondern wurden bis zur Schmerzgrenze an die Gehaltssituation der Neuankömmlinge angepasst. Und immer mehr wollen deshalb gar nicht mehr kommen.
Der Container wird zum Modul
Unternehmen wie 99Designs haben schon die Konsequenzen gezogen und sind aus dem teuren Financial District in San Francico nach Oakland weitergezogen, in die sogenannte „East Bay“. „Die größte Überraschung“, so Vorstandschef Patrick Llewellyn gegenüber dem Handelsblatt, „war die Reaktion der Belegschaft“. Er hatte mit Verärgerung gerechnet, aber es gab großen Jubel. Fast alle Mitarbeiter hatten schon längst San Francisco Richtung East Bay verlassen und waren froh, dass die Firma jetzt folgte.
Der Milliardenkonzern GE baute gar direkt im verschlafenen San Ramon, weit weg vom Silicon Valley in der East Bay seine neue Forschungszentrale, die in weniger als fünf Jahren von null auf über 1200 Software-Ingenieure angewachsen ist. Amy Sarosiek von GE Research sieht hier sogar einen echten Vorteil, wenn es um Top-Talente geht. „Wer zu uns kommt, hat schon eine andere Lebensplanung. Er will ein Haus und eine Familie und nicht jeden Morgen im Stau stehen.“ Es kämen laufend Bewerbungen aus allen namhaften Unternehmen.
Hilfe verspricht Google sich dagegen wie immer durch Technologie. Das Start-up Factory OS ist spezialisiert auf „Modulwohnungen“ und soll das Problem lösen. Im Werk vorgefertigte und vor Ort zusammengestapelte Module hört sich besser an als „Containerdorf“ oder gar „Trailerpark“. Das sind die Wohnwagen-Parks, auf die alle herunterschauen. Denn da wohnen die, die es gerade noch mal knapp an der Obdachlosigkeit vorbeigeschafft haben. Aber wenn es ein Modul ist und ein Tesla vor der Tür parkt, ist das „hip“. Eine Investition von 25 bis 30 Millionen Dollar schafft nach Informationen des „Wall Street Journal“ Wohnraum für zunächst 300 Google-Mitarbeiter. Die Erstellungskosten sollen pro Einheit bis zu 20 Prozent unter traditionellem Bau liegen, verspricht die Webseite von Factory OS.
Google selbst will das nicht kommentieren. Aber, so das Journal, die Wohnungen werden auf dem Moffett-Field, einem ehemaligen Nasa-Gelände, entstehen, praktisch in Sichtweite des geplanten neuen Google-Hauptquartiers, das Apples Raumschiff wie eine jämmerliche fliegende Untertasse aussehen lassen soll. Noch ein Grund weniger für die Bewohner der Modulgebäude, sich nur als Trailer-Park-Bewohner mit fettem Gehaltsscheck zu fühlen.
Denn der Gehaltsscheck ist der einzige Unterschied. Die Universitätsstadt Berkeley hat im Februar auch Pläne für „Pods“, vorgefertigte Wohnkapseln, angekündigt. In ihnen sollen „echte“ Obdachlose unterkommen, die sonst auf der Straße leben müssen. San Francisco überlegt, 200 oder mehr der 15 Quadratmeter großen Fertigbau-Zellen aufzustellen, ist aber noch unschlüssig. Denn der Entwickler will trotzdem noch 1000 Dollar Miete pro Monat von der Stadt, pro Einheit und Monat.
Wie groß die einzelne Modulwohnung von Google werden, ist nicht klar. Aber sie dürften zumindest zum Teil über den Mindestgrößen liegen, die Mountain View erlaubt. Dass über solche Optionen überhaupt geredet wird, liegt an einem Vorstoß der privaten Wohnungsbau-Wirtschaft. Sie konnte San Francisco 2012 überzeugen, die gesetzliche Mindestgröße für Miet- und Eigentumswohnungen deutlich auf 20 Quadratmeter zu reduzieren und trat damit eine Lawine los. Das Ergebnis: Renovierte Altbauwohnungen mit 22 Quadratmetern Grundfläche, von denen die erste 2016 für sagenhafte 425.000 Dollar verkauft wurde. Man muss eingestehen: Das ist immerhin fast dreimal so groß wie eine durchschnittliche Gefängniszelle in den USA.
Eigentlich könnte man da schon fast überlegen, die Gefängnisinsel Alcatraz in der San Francisco Bay als Luxusimmobile wieder auferstehen zu lassen.
Immer dienstags schreiben Britta Weddeling und Axel Postinett, Korrespondenten des Handelsblatts im Silicon Valley, über neue Trends und den digitalen Zeitgeist im Tal der Nerds.

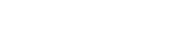 Yahoo Kino
Yahoo Kino 

