Auf diese fünf Filme hätten wir 2018 verzichten können!
“Nobody’s perfect”, heißt es am Ende von Billy Wilders Komödie “Manche mögen’s heiß”. Diese Binsenweisheit lässt sich natürlich auch auf die Filmbranche beziehen, in der bekanntermaßen nicht nur Meisterwerke wie das von Wilder entstehen. Wir haben aus der Vielzahl der schlechten Filme, die uns dieses Jahr gelangweilt, gequält und geärgert haben, fünf herausgegriffen.

Komödien von heute: nichts zu lachen
Wenn es gilt, sich etwa für einen Jahresrückblick auf die fünf schlechtesten Filme des Jahres festzulegen, landet man zwangsläufig im Komödienfach. Nicht von ungefähr, denn das Genre hat – zumindest im Mainstream-Bereich – in den letzten Jahren einen solchen Tiefpunkt erreicht, dass man bei so manchem Film zögert, überhaupt von Komödie zu sprechen. Wie im Fall von “Der Sex Pakt”. Der Film kreist um zwei besorgte Väter und eine nicht weniger ihr Kind liebende Mutter, die erfahren, dass ihre Töchter beim Abschlussball endlich ihre Unschuld verlieren wollen. Unfassbar! Darum beschließen die drei Helikopter-Eltern, das schreckliche Vorhaben zu sabotieren. Wie sie das erreichen wollen? Nun, wir befinden uns in einer US-Komödie, das Stichwort lautet: Party-Crashing.
Also machen sich die Mama und die Papas daran, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Natürlich geht dabei manches schief, wird in jedes Fettnäpfchen getreten und – auf Seiten der Filmemacher – kein noch so grobschlächtiger Gag ausgelassen. Einer davon geht wie folgt. Die Alten landen bei ihrer heilig-ernsten Mission irgendwann auf einer Party (Stichwort: Party-Crashing), wo die jungen Leute natürlich reichlich Alkohol konsumieren. Besonders gern tun sie das im Rahmen eines Spiels namens “Arschsaufen”. Wie es funktioniert? Ganz einfach: Es gibt einen Trichter und einen Schlauch, und der Schlauch wird, genau: in das Körperteil eingeführt, das dem Spiel seinen Namen gibt.
Nach der plumpen Logik von “Der Sex Pakt” muss natürlich auch einer der Väter sich den Schlauch in seinen After einführen lassen. Die Motivation dafür liefern die Drehbuchautoren gleich mit: Mann will ja vor den Jungen nicht als prüder alter Knacker dastehen. Und tatsächlich: Schon bald fließt das Bier in den Allerwertesten des Allerdämlichsten – und während die Jungen lachen, leiden und mitleiden die Alten. Was noch fehlt, ist die Pointe des Ganzen, die denn auch prompt folgt. Der zweite Tölpel der drei Sex-Saboteure hält seine Visage zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt vor den Trichter. Es passiert, was passieren muss – und der Zuschauer längst erahnt hat: Der Darm des “Arschsäufers” kann das Gesöff nicht mehr halten, er entleert sich und das “Arschbier” (Zitat aus dem Film) landet im Mund des Kumpels.

Plump und peinlich
Diese Szene ist beispielhaft nicht nur für die Qualität von “Der Sex Pakt“, sondern überhaupt für das humoristische Niveau vieler heutiger Mainstream-Komödien. An ihr wird auch deutlich, wie grundlegend sich das Humorverständnis in den letzten Jahren gewandelt hat. Komiker von heute – und zwar nicht nur die in Hollywood – glauben offenbar, dass komisch ist, was unter die Gürtellinie zielt. Subtilität und Feingeist? Das war gestern, eine Sache von Ernst Lubitsch und Billy Wilder. Heute sollte eine Komödie den schlechten Geschmack bedienen und am Peinlichkeitsempfinden des Zuschauers rühren. Deshalb zielen die Komiker gerne gegen den menschlichen Körper, der entweder in seiner Lächerlichkeit dargestellt oder in seiner Mechanik gezeigt wird. Und wird man als Zuschauer unentwegt mit Arsch-, Titten-, Eier- und Hämorrhoiden-Witzen, mit Furz-, Kotz- und Rülps-Gags behelligt.
Bezeichnend auch, dass sich mit dem Furz- und Fäkal-Humor offenbar auch das Zielpublikum gewandelt hat. Die plumpen Gags wider die vermeintlichen Tabus und den guten Geschmack sind nicht für den einzelnen Zuschauer gedacht. Angesprochen wird ein größeres Publikum, eine Masse, mindestens eine Gruppe im Kinosaal, die sich nicht an einem subtilen Witz begeistern, sondern gemeinschaftlich einen plumpen und obszönen Gag abfeiern will. Worum es den “Arschbier”-Komikern letztlich also geht, ist bestenfalls die Schaffung eines Kults, der eher mit Tabubrüchen und Grenzüberschreitungen zu erzielen ist als mit der taktvollen Einhaltung von Konventionen und dem Respekt vor dem guten Geschmack.

Slapstick war einmal
Bestenfalls, denn so einfach ist es dann doch wieder nicht mit dem Kult. Denn ein Kunstwerk braucht schon etwas mehr als bloß Tabu-Brüche und Geschmacksverletzungen. Weshalb der grob- und gröberschlächtige “Der Sex Pakt” nicht Kult, sondern einfach nur Gaga ist. Genauso wie “Johnny English – Man lebt nur dreimal“. Die Agentenparodie ist zwar frei von Körperausscheidungswitzen, sonderlich subtil ist der dritte Auftritt des Titelhelden dennoch nicht geraten. Im Gegenteil, der Film ist bezeichnend dafür, für wenig intelligent nicht nur die Macher dieses Films die Zuschauer halten. Das Motto der Drehbuchautoren schien hier ganz offensichtlich zu lauten: Wir schreiben plumpe Gags, weil der potenzielle Zuschauer die subtilen eh nicht verstehen würde.
Also lassen sie ihre Figuren die Witze erklären, bevor sie sie zum Besten gegeben. Dem dummen Zuschauer könnte ja die Pointe einer Szene entgehen. Dass sich unter ihnen vielleicht der eine oder andere Fan von Rowan Atkinson befinden könnte, der mal zu den klügsten Komikern England gehörte, ignorieren sie schlicht. Atkinson gibt sich zwar sichtlich Mühe, um an seine Slapstick-Kunst früherer Tage anzuknüpfen, doch was nützt die Anstrengung angesichts eines schwachen Drehbuchs? Vom feinnervigen Humor jedenfalls von Atkinsons Fernsehsketche oder der Sitcom “Mr. Bean” sind die uninspirierten Gags ist “Johnny English 3” so weit entfernt wie das “J” vom “H” im Namen des Titelhelden.

Zeitkritik mit Zeigefinger
Wie Atkinson mit “Johnny English – Man lebt nur dreimal” zu keinem Zeitpunkt sein einstiges Niveau erreicht, so scheitert Rudi Gaul mit “Safari – Match Me If You Can” an seinen Vorbilden. Der Regisseur und Ko-Drehbuchautor hatte mit seinem dritten Spielfilm wohl so etwas wie eine filmische Kreuzung aus Steven Spielbergs “Catch Me If You Can” und den Episodenfilmen von Robert Altman im Sinn. Gelungen ist ihm weder eine leichtfüßig inszenierte Hochstapler-Komödie noch ein zeitgeistiger Episodenfilm. Ärgerlicher als die vielen dramaturgischen Lücken, die platten Gags und die schematische Figurenzeichnung des Films ist die plakativ vorgetragene Gesellschaftskritik. Das Bild, das “Safari” von unserer Wirklichkeit zeichnet, ist in etwa so wahrhaftig wie ein x-beliebiger Werbespot. Wie in einer Reklame das beworbene Produkt das Epizentrum der Welt ist, so besteht in “Safari” unsere Zeit ausnahmslos aus Smartphones und Dating-Apps und aus Menschen, die diese Technik widerspruchslos in Anspruch nehmen. Nein, das Kino kann schon mehr als Halbweisheiten zu vermitteln, die man auch in den Kommentar-Foren eines sozialen Netzwerks finden kann.
Auch “Meg” entstand offensichtlich aus dem Geiste eines berühmten Vorbildes. Doch während Steven Spielbergs “Der weiße Hai” Filmgeschichte schrieb, dürfte der Zuschauer “Meg” schon vergessen haben, bevor er den Kinosaal verließ. Der Horror-Thriller steht dafür, wie das aktuelle Mainstream-Kinos eine Genre-Prämisse pervertiert, die das fantastische Kino seit je her pflegt und Spielberg mit seinem Hai-Klassiker perfektioniert hat: dass das Monster nämlich in einem Horrorfilm überlebensgroß dargestellt werden muss. In “Meg” ist der Urzeithai nicht nur groß, nein, er in etwa so riesig wie eine Stadt. Überdimensioniert in dem Machwerk sind leider auch die Klischees und die dramaturgischen Löcher. Winzig klein dürfte dagegen der Ehrgeiz der Filmemacher gewesen sein, einen auch nur ansatzweise inspirierten Film zu realisieren.

Der Rest ist Schweigen
Dass kreativer Ehrgeiz nicht zwangsläufig ein Meisterwerk zur Folge hat, dafür steht “Mute“. Duncan Jones, der Sohn der kürzlich verstorbenen Rock-Ikone David Bowie, bezeichnete das Science-Fiction-Drama als sein Herzensprojekt. Lange hat er daran gearbeitet und noch länger war er um Geldgeber bemüht. Doch die Umsetzung der Geschichte um einen stummen Barkeeper, der im Berlin des Jahres 2052 nach der Liebe seines Lebens sucht, scheiterte immer wieder an fehlendem Kapital. Kaum ein Produzent traute sich, das Projekt zu finanzieren. Wahrscheinlich sahen sie im Drehbuch, was der Film schließlich einlöste: “Mute” ist ein zerfahrener Film, dessen Figuren, Ideen, Motive und Themen sich nicht in ein Ganzes fügen wollen. Jones hatte sich 2010 mit dem hochgelobten Sci-Fi-Drama “Moon” als vielversprechender Filmemacher aufgestellt. Nach dem allenfalls beachtlichen Mystery-Thriller “Source Code” legte er mit der Videospiel-Verfilmung “Warcraft: The Beginning” eine künstlerische Bruchlandung hin. “Mute” setzt den Negativtrend fort. Der Film soll nach “Moon” der zweite Teil einer Trilogie sein. Angesichts seiner Qualität wird es Jones wieder schwer haben, den finalen Teil zu finanzieren.

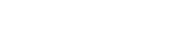 Yahoo Kino
Yahoo Kino 
